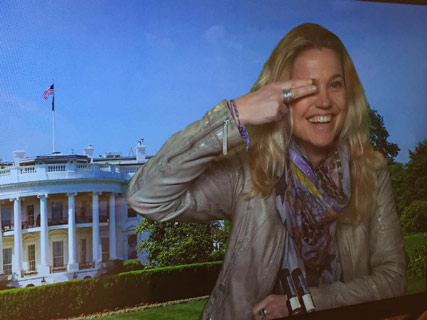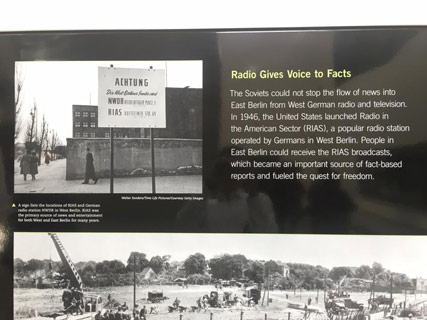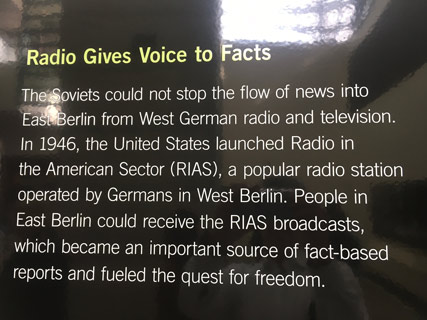Dreiwöchige USA-Journalistenprogramme 2017
im Frühjahr und Herbst jedes Jahres
USA-Frühjahrsprogramm
14.–31. März 2017
Zehn deutsche Journalisten in den USA: Organisiertes Programm in Washington D.C. sowie für alle Teilnehmer jeweils ein individuelles Praktikum in einer amerikanischen Rundfunk- oder Fernsehstation, Abschlusswoche in New York.
TEILNEHMERBERICHTE
USA-Frühjahrsprogramm
Sabine Adler, Deutschlandradio, Berlin
St. Louis Public Radio – 90,7 KWMU
„Ist die Demokratie in den USA in Gefahr?“ fragten sich nach dem Wahlsieg von Donald Trump nicht nur Amerika-Kritiker in Deutschland. In seiner Inaugurationsrede erhob der neue Präsident „America first“ zum Programm. Seine ersten Executive Orders mit der beabsichtigen Abschaffung der von Obama initiierten Krankenversicherung „Affordable Health Care“, der verhängte Einreisestopp für Bürger aus sieben überwiegend muslimischen Ländern waren Schritte, die die Sorge nach dem polarisierenden Präsidentschaftswahlkampf zusätzlich erhöhten. Nach unzähligen Gesprächen und Interviews in Washington, St. Louis, Ferguson und New York lautet das Fazit: Die amerikanische Demokratie ist stark und wird nicht so schnell zu zerstören sein, weil viele Amerikaner für ihre Verteidigung bereitstehen, denn die Verfassung ist für sie ein hohes Gut. Sie sehen die Bedrohung, teilen die Besorgnis.
Ernsthafte Redaktionen gehen der möglichen Motivation von Trump-Wählern nach, was auch für deutsche Medien öfter Thema sein sollte. Zwei Begegnungen mit selbsterklärten Unterstützern des Präsidenten bestätigten zum einen, dass es sich meist um weiße, ältere, katholische Männer handelt, die oft aus kleineren Orten stammen, zum anderen aber erklärte ein Wähler, auf den diese Kriterien ebenfalls zutrafen, dass er außerdem zwei Kinder habe, geschieden und homosexuell sei, zudem mit einem Nachbarn befreundet sei, der schwarz und ein demokratischer Lokalpolitiker sei. Ein genauerer Blick lohnt immer, es ist kein Verlass auf Vorurteile.
So beruhigend das Engagement von Richtern, Zivilgesellschaft und Presse für die demokratische Verfasstheit auch sein mag, bescherte die dreiwöchige Reise durchs Land eine äußerst niederschmetternde Erkenntnis: Rassismus ist immer noch weit verbreitet, speziell gegen Schwarze. Ferguson ist nicht nur (fast) überall, die Gleichmütigkeit, mit der Weiße die alltägliche Diskriminierung von Schwarzen hinnehmen, weil sie sie nicht betrifft, ist eine erstaunliche und bittere Erkenntnis. Die allerwenigsten Weißen setzen sich aktiv für die Gleichbehandlung ihrer schwarzen Mitbürger ein. Einige Aktivisten schilderten, dass sie sich für ihre Ignoranz heute schämen, mit der sie die Rassendiskriminierung jahrelang selbst zugelassen haben. Sie bedauern diesen Fehler und versuchen jetzt, ihn zu korrigieren.
Dass Städte ihre Haushaltsbudgets zum großen Teil über Strafmandaten für Verkehrsdelikte finanzierten, empfinden auch viele Weiße als einen Skandal. Diese Praxis wurde nach den Rassenunruhen in Ferguson zwar eingeschränkt, dennoch werden vor allem schwarze junge Männer weitaus häufiger als jede andere Bevölkerungsgruppe kontrolliert und auch drangsaliert. Ihr Vertrauen in die Polizei ist dementsprechend gering, sie rufen sie nicht, obwohl sie sie besonders in ihren Wohngegenden häufiger als anderswo brauchen würden.
Wer sich bemüht, den Konflikten nachzugehen, findet offene Gesprächspartner und eine große Bereitschaft und Gastfreundschaft. In Ferguson und St. Louis sprachen Interviewpartner Einladungen zu sich nach Hause aus und berichteten mit großer Ausdauer über das Thema „Black lives matter“.
Die Holboke-Highschool in New Jersey nimmt sich unterschiedslos der Schüler an, vermittelt ihnen viel Selbstwertgefühl und bereitet sie mit Unterrichtsfächern, von denen deutsche Schüler nie gehört haben, sehr praktisch auf das Leben vor. Zum Beispiel in den Fächern „Justizwesen“ oder „Ökonomie“ lernen sie ihre Rechte und Pflichten als junge Staatsbürger kennen bzw. einen Studienkredit für den Collegebesuch einzuschätzen.
Von dem schon sprichwörtlichen amerikanischen Bürger-Engagement profitieren New Yorker Obdachlose und andere Bedürftige in der St. James Church, in dem nicht einfach nur Suppe an sie verteilt wird, sondern einmal pro Woche ein Menü serviert bekommen, gekocht von alten und jungen Bewohnern des Viertels, die allen Konfessionen angehören und nur ein Ziel haben: Den Ärmsten etwas Gutes zu tun, wissend, dass jeden — schneller als er denkt — ein ähnlicher Schicksalsschlag ereilen kann.
Ein schwarz-weißes USA-Bild taugt zur Beschreibung der Realität trotz der enormen Polarisierung wenig, durch das RIAS-Programm kamen viele Grau-Abstufungen hin. So wird es genauer.
Kevin Arnold, HessischerRundfunk, Frankfurt a.M.
Einundzwanzigkommafünf Kilo. Das zeigt die Digitalanzeige der Kofferwaage am Schalter am Frankfurter Flughafen. Einundzwanzigkommafünf — das ist die Obergrenze, das Maximalgewicht für einen Koffer für meinen Flug nach Washington. Und maximal ist auch die Zahl der Sorgen und der Fragen an die USA, die ich mit mir rumschleppe.
Präsident Trump ist zu diesem Zeitpunkt gerade einmal rund 50 Tage im Amt. Er und seine Leute haben in kurzer Zeit für Chaos und Verunsicherung gesorgt. Exekutiv-Anweisungen des Präsidenten greifen ein in die fundamentalen Freiheitsrechte. Uns Alliierte stößt er vor den Kopf. Obamas wichtige Kehrtwende in der Klimapolitik dreht er ins Absurde. Den hasserfüllten Tonfall aus dem Wahlkampf behält er auch als Präsident bei. Und Chef-Stratege Steve Bannon erklärt öffentlich, er wolle den Staat auseinander bauen. Das Ende unserer Demokratie? Das Ende unserer Werte? Das Ende des Westens?
Im Flieger nach Washington gehe ich meine Unterlagen durch: Konstruktiver Journalismus — haben die U.S.-Kollegen damit irgendwas am Hut? Der Populismus und die Medien — wie haben die Journalisten ihre Rolle beim Wahlsieg des politisch völlig unerfahrenen, selbst-erklärten Top-Deal-Makers reflektiert? Haben Sie schon Lehren für uns parat für den Umgang mit „unseren“ Populisten? Auf all diese Fragen wird das RIAS-Programm eine Antwort haben.
Das Programm bringt mich und neun andere deutsche Journalisten zuerst nach Washington. Schnee, Eiseskälte, interessante Sitzungen und herrliche Abendstunden schweißen uns schnell zusammen. Wir machen Selfies und Gruppenfotos vor Weißem Haus und Kapitol. RIAS-Koordinator Jon Ebinger und RIAS-Verwaltungsdirektor Eric Kirschbaum führen uns in Radio- und Fernseh-Stationen, wir treffen Wissenschaftler aus Denkfabriken und Mitarbeiter von Nicht-Regierungsorganisationen. Es geht um Trump, Trump und nochmals Trump. Und ich habe meine ersten Aha-Momente.
Ein Sitzungsraum im PEW-Research-Center. Eine Denk-Fabrik, die sich vorgenommen hat, Fakten zu politischen Diskussionen zu liefern. Wir werfen die Frage in den Raum: „Aus Ihrer Sicht: Sind die USA gespaltener denn je?“ Die Antwort lautet sinngemäß: Ihr wisst schon, dass wir während der Bürgerrechtsbewegung in den 1960er Jahren Tote auf den Straßen hatten? — Stimmt. Es war wirklich schon mal schlimmer. Mir fällt das Protestlied von damals ein: We shall overcome. Überwunden haben wir die Spaltung zwar noch nicht, aber sie war wirklich schon mal schlimmer.
Und auch etwas anderes haben wir schon mal gesehen. Trump beschimpft uns als „crooked media“ und als „enemies of the people“. In Deutschland ist das Stichwort dazu „Lügenpresse“. Ist das ein Schlammassel, aus dem wir nicht mehr rauskommen? Nein. Im Newseum in Washington zeigt eine Ausstellung zur Rolle der Medien dieses historische Foto: Eine Protestierende hält ein Schild hoch mit der Aufschrift: „No more media liars.“ Ich weiß in diesem Moment nicht, von wann diese Aufnahme ist. Aber ich weiß: Okay, das Problem hatten Journalisten vor uns auch schon. Und wir haben uns berappelt. Berappelt sich auch das amerikanische System? Kommt die Gesellschaft wieder zusammen?
Manchmal hilft bei solchen Fragen etwas Pathos. Bei einer Führung durch das Kapitol, dem Sitz des U.S.-Kongresses, schmettert er reichlich auf uns nieder. Nimm diese Errungenschaft! Nimm diesen moralischen Wert! Und besser aufnehmen kannst Du das mit der heroischen Musik, die wir in Dein Ohr blasen. Und am Schluss schwebt auf einer Riesen-Leinwand der Wahlspruch: E pluribus unum. Out of many, one. Dass die Amerikaner das ernst meinen, dieser Eindruck verfestigt sich in den nächsten Tagen.
Im Brookings Institute, einer liberalen Denkfabrik, sitzt uns die Expertin für den Kongress gegenüber. Sie führt uns überzeugend vor Augen: Der Präsident kann zwar seine zerstörerischen Initiativen starten. Zum Beispiel seinen Entwurf zu einem Haushalt, der vorsieht, die Gelder gegen Epidemien im Ausland zusammen zu streichen und die Umweltprogramme zu begraben. Aber über Geld entscheidet letztlich der Kongress. Und ob dieser all dem zustimmt, ist mehr als fraglich. Und dass die Amerikaner groß sein können im Brücken bauen, das zeigt sich später noch im RIAS-Programm.
Nach einer knappen Woche in Washington spaltet sich unsere kleine RIAS-Fellowship auf. Jeder besucht eine andere Stadt im Land und hospitiert dort bei einem Sender. Ich darf nach Boston, Massachusetts — im 18. Jahrhundert Zentrum der amerikanischen Unabhängigkeitsbewegung, heute selbst-erklärtes Zentrum der Innovation. Hübsch restaurierte und verzierte Backsteingebäude stehen eingekreist von Wolkenkratzern. Vom friedlichen Park Boston Common führt der sogenannte Freedom Trail zu den wichtigsten Sehenswürdigkeiten der Stadt. Immer wieder drängt sich der Geruch von Marijuana in die Nase, das in diesem Bundesstaat seit kurzem legal ist, und viele Lokale werben mit knall-roten Hummern.
Ich steige in die U-Bahn und fahre zu meinem Radio-Sender: WBUR. Er liegt etwas außerhalb des Zentrums, ist angedockt an die Universität und gehört zum Netzwerk des öffentlich-rechtlichen Rundfunks, dem National Public Radio. Empfangen werde ich von Yasmin, die vor kurzem als RIAS-Fellow in Deutschland war, und jetzt meine Gastgeberin ist. Sie stellt mich den Kollegen im Sender vor, zeigt mir die Arbeit und lässt mir viel Freiraum, um mit Kollegen zu sprechen und selbst Dinge auszuprobieren. Großartig! Ich lerne Nachrichten schreiben auf amerikanische Art und gewinne den Eindruck, wie man auch in einem Spenden-gestützten System tiefgehendes, anspruchsvolles Programm machen kann. WBUR setzt gezielt konstruktive Akzente im Programm und die Kollegen versuchen regelmäßig aus ihrer Blase auszubrechen, indem sie die Perspektive von Trump-Anhängern einholen. Daneben spreche ich mit Reportern, Programmchefs und allein eine gefühlte Ewigkeit mit dem Pförtner, Nathaniel. Ein robuster Schwarzer mit Minipli, der redet, als würde er als Pfarrer dem Sonntags-Gospelchor einheizen. Seine Botschaft: „Dass Präsident Trump die Gesellschaft mit Hass-Botschaften überzieht, macht für mich keinen Unterschied. Ich bin mein ganzen Leben lang mit Hass überzogen worden.“ Trotzdem strahlt dieser Mann so viel Offenheit und Herzlichkeit aus. Ein Brückenbauer. Und er sollte bald Gesellschaft von 12tausend weiteren bekommen.
Freitagabend, die Sporthalle TD Garden. Neben dem Baseball-Stadion der Stadt, Fenway Park, ist TD Garden der Tempel von Boston. Fast jeden Abend spielt hier in dieser Woche eine Profi-Mannschaft. Heute Abend gibt es NBA-Basketball: Boston Celtics gegen die Phoenix Suns. Die Gastgeber führen schnell haushoch. Die knapp 12tausend Fans feiern ihre Celtics, der Gegner aus Phoenix kriegt gelegentlich Buh-Rufe und Häme ab. Doch im letzten Viertel passiert etwas: Ein Spieler der gegnerischen Suns wirft einen Korb und bekommt dafür Applaus und Jubel von den Celtic-Fans! Wieso das? Die Anzeige über dem Spielfeld verrät: Der Spieler, Devin Booker, hat inzwischen 50 Punkte auf dem Konto. Für jeden weiteren Punkt wird dieser gegnerische Spieler von den Heim-Fans gefeiert. Am Ende schafft der 21jährige 70 Punkte und stellt damit mehrere Rekorde auf. Man stelle sich vor: Bayern-Stürmer Robert Lewandowski wird von Dortmund-Fans gefeiert, weil er im Dortmunder Stadion sein 41 Saison-Tor schießt und damit einen neuen Rekord aufstellt. In Deutschland undenkbar. In den USA dagegen kann selbst ein Gegner bejubelt werden, weil er für seine Leistung respektiert wird. Die Amerikaner können wirklich Brücken bauen.
Diese Fähigkeit steckt ganz offenkundig tief drin in der Gesellschaft. Das sehen wir auch später in New York. Wir helfen relativ wohlhabenden Menschen, ein aufwändiges Mittagessen für Bedürftige zu zaubern. Wir treffen jugendliche Schüler an der Hoboken-Highschool, allesamt Migranten-Kinder, die so viel Respekt füreinander zeigen, dass es ergreifend ist.
Natürlich sehen wir neben Trump auch andere Probleme, die die USA mit sich tragen. Unerträgliche Armut neben protzigem Reichtum. Verkehrslärm, Energieverschwendung und Plastikmüll ohne Ende. Überleben nur mit zwei Jobs möglich, immer getrieben sein von „hire and fire“. Unser RIAS-Programm vertieft in mir den Eindruck: Die USA sind in der Lage, das denkbar Schlimmste auf der Welt hervorzubringen, aber auch das denkbar Beste.
Letzter Tag. Abreise. Flughafen Newark bei New York. Die Kofferwaage zeigt vierundzwanzig Kilo. Zweieinhalb mehr als bei der Hinreise. Erklärung? Mehr Gepäck habe ich eigentlich nicht. Und meine Sorgen und Fragen sind auch weniger geworden. Dafür bin ich jetzt reich an Erfahrung, reich an neuem Wissen, reich an neuen, wunderbaren Freunden und reich an Zuversicht, dass die USA das schon schaffen werden. We shall overcome. E pluribus unum. Out of many, one.
Johannes Damian, Deutsche Welle TV, Berlin
März 2017 – auf jeden Fall ein spannender Moment für eine journalistische Reise in die USA. Donald Trump ist genau 50 Tage im Amt. Die ganze Welt schaut fasziniert und verunsichert auf den neuen US-Präsidenten. In Europa scheint niemand zu wissen, wie soll man umgehen mit diesem Partner? Und auch die US-Medien machen einen etwas verlorenen Eindruck beim Versuch, die Bedeutung all der präsidialen Tweets zu deuten und zu erahnen, was denn nun Mr. Trumps politische Agenda sei. Gerade hatte er den umstrittenen Einreise-Bann erlassen. Jetzt macht er sich daran, Obamas Gesundheitsreform rückgängig zu machen. Bereits vor der Reise war klar, dass das Thema Trump alles andere überragen würde.
„I need a plausible story“
Schon meine Anreise ist mit einigen Hürden verbunden: Flughafenstreik in Berlin, Schneesturm an der Ostküste der USA. Und was verschärfte Einreisekontrollen sind, bekomme ich dann auch vorgeführt. Während die Kolleginnen und Kollegen, die mit mir im Flieger saßen, problemlos durch die Kontrollen kommen, will mir der Beamte der Customs and Border Protection nicht so recht glauben, dass ich nur als Tourist unterwegs bin: „I need a plausible story“. Nach einem längeren Frage-und-Antwort-Spiel (Nein, ich war noch nie im Jemen. Nein, ich will kein US-Bürger werden. Nein, ich trage keine Waffe und habe auch keine Früchte dabei…) bekomme ich dann doch meinen Stempel in den Pass. Eine Halle weiter aber beim Zoll heißt es dann „this way please…“ und ich darf eine Extrarunde drehen: Den Pass hier lassen, hinsetzen, wir rufen Sie auf. Zwei Stunden lang sitze ich in einer Halle mit etwa 20 anderen Reisenden aus Afghanistan, aus Osteuropa und Südostasien. Einer nach dem anderen wird aufgerufen, Koffer werden geöffnet, Päckchen mit dem Messer aufgeschlitzt, Laptops und Smartphones durchsucht. Unangenehme Situation. Nach zwei Stunden dann ruft mich ein Beamter auf und reicht mir mit gleichgültiger Miene meinen Pass. „That‘s it?“ – „Yes“.
„Keep reporting every single day“
Für den Tag unserer Ankunft in Washington D.C. waren eigentlich die berühmten Kirschblüten vorhergesagt. Und Kanzlerin Merkel hatte einen Besuch bei ihrem US-amerikanischen Kollegen geplant. Die Kirschblüten aber fielen dem Blizzard zum Opfer und Merkels Besuch wurde erstmal verschoben. Sprunghaft und unvorhersehbar – Zwei Kategorien, die uns bei unseren Gesprächen mit Think Tanks und Medienunternehmen immer wieder begegnen sollten. Ob bei Pew Research und Brookings, ob bei NPR oder abc News. Immer wieder fangen die Antworten an mit: „Das kommt darauf an, was Morgen…“. Alle sind überrascht von der Geschwindigkeit, mit der sich die politische Agenda entwickelt. Und alle sind sich einig: So eine Präsidentschaft hat es noch nicht gegeben. Solche Herausforderungen für die Presse, für die Wissenschaft und für die Gesellschaft. Aber gleichzeitig ist auch klar: Guter Journalismus ist jetzt gefragt wie lange nicht. Ja, die Medien haben Fehler gemacht. Ja, die herkömmlichen Umfragemethoden müssen überarbeitet werden. Aber neben Unsicherheit und Frustration scheint Mr. Trump vor allem aufzurütteln und anzuspornen. Auf die immer wieder gestellte Frage, was die Medien denn tun können, wenn der Präsident es mit den Fakten nicht so genau nimmt und die Presse als Feinde des Volkes bezeichnet, immer wieder die gleiche Antwort: „keep reporting every single day.“
San Antonio – eine blaue Insel in einem roten Meer
Hospitieren bei einer Fox-Filiale in Texas: Endlich raus aus der liberalen Ostküstenblase, endlich ein Einblick in das „wahre Amerika“. Große Autos, dicke Steaks, Waffennarren mit Cowboy-Hüten – so meine ersten Gedanken. Mit den Autos sollte ich rechte behalten. Beim Rest: Weit gefehlt. San Antonio ist eine von wenigen liberalen Inseln im ansonsten republikanischen Texas. Über die Hälfte der Wähler in Bexar County rund um San Antonio hat für Clinton gestimmt, nur knapp 40 Prozent für Trump. Mehr als 60 Prozent der Menschen hier sind Latinos. Das Erbe der spanischen Eroberer und der Zeit, als Texas noch zu Mexiko gehörte, durchdringt die gesamte Kultur. Die koloniale Architektur der Altstadt mit der ältesten Kathedrale der USA, der Festung El Álamo und dem Gouverneurspalast. Typisches essen sind nicht Steak und Rippchen, sondern Tacos, Enchiladas, Quesadillas.
Viele meiner Kolleginnen und Kollegen bei Fox 29 gehören zur zweiten, dritten oder x-ten Generation von Einwanderern aus Mexiko, Zentral- oder Südamerika. Auch die Familie meiner Gastgeberin Yami kommt aus Panama. Sie ist zweisprachig Englisch-Spanisch aufgewachsen. Ihr Schwerpunkt bei Fox29: Crime. Yami hat sehr gute Kontakte zu den lokalen Sicherheitsbehörden, dem Sherriff‘s department, den US Marhalls etc. Sie dreht Reportagen zu Gang-Verbrechen und moderiert Sendungen über die Schwersten Jungs, die gerade auf der Flucht sind – „Marshals Most Wanted“. Neben Verkehr und Wetter bringt das dem Lokalsender die meiste Quote. Im Großraum San Antonio leben etwa 2,2 Millionen Menschen, vergleichbar also mit dem Münchner Ballungsraum. Die Tage mit Yami führen mir aber noch einmal vor Augen, dass das Ausmaß an Gewaltverbrechen in den USA nicht im Mindesten vergleichbar mit den Verhältnissen in Deutschland ist. Fast kein Tag vergeht ohne kleinere oder größere Schießereien, Messerstechereien, Gang-Gewalt und Mord. San Antonio liegt genau am Drehkreuz der Interstates I-35 und I-10 – hier kann man durchfahren von Kanada bis Mexiko, von Florida bis Kalifornien. Ein wichtiger Umschlagplatz für die Drogenmafia.
Texas – Tag 2 – County Jail
Gleich am zweiten Tag bekomme ich einen direkten Eiblick in diese Welt: Bobby, ein alter Freund von Yami ist stellvertretender Leiter des Bexar County Jail. Einen halben Tag lang führt er mich durch das sechstgrößte Gefängnis von Texas mit seinen über 3.000 Insassen. Gleich zu Beginn des Rundgangs finde ich es zumindest ein klein wenig beunruhigend, als wir den Fahrstuhl mit drei Männern in cremefarbener Häftlingskleidung, unbegleitet und ohne Handschellen teilen. Bobby macht ein wenig small talk, die seien alle „low risk“ beruhigt er mich. Wir beginnen den Rundgang beim „Booking“. Hier kommen alle durch: Kleinkriminelle, Mörder, Gang-Mitglieder. Durchdringende Blicke, denen ich nicht standhalte, es riecht nach Schweiß und Urin. Fingerabdrücke werden genommen, Tattoos untersucht und klassifiziert, denn die Gangs müssen getrennt werden, sonst gibt es Tote. Bobby wirkt entspannt, hält einen Plausch mit den Kollegen. Weiter geht es durch Küche, Wäscherei, Krankenstation, Kappelle und „Lernzentrum“. Eine ganze Reihe der Wachleute, Ärzte und auch der Geistliche kennen Germany, waren dort privat, zum Studium oder – wie die meisten – mit dem Militär. Zum Abschluss: Die Gang-Unit. Aus einer zwei Quadratmeter großen Wach-Box heraus geht der Blick links auf eine Reihe geschlossener Zellen. In den Fenstern tauchen Schatten auf, ab und zu Hände, die per Zeichensprache kommunizieren. Alle 20 Minuten macht ein Officer die Runde, leuchtet mit einer Taschenlampe durch die Zellenfenster. Texas, das war für mich viel Polizei, viel Crime, viel Gewalt – zumindest während meiner Arbeit im Investigative Department von Fox29. Abends mit meinen Kolleginnen und Kollegen und bei meinen Spaziergängen durch die Stadt lerne ich ein entspanntes, offenherziges Texas kennen. Eine Stadt, zwei Welten, wie sie gegensätzlicher kaum sein könnten. San Antonio, ich komme gerne wieder.
New York City
New York – mehr Klischee geht wohl kaum. Wie viele tausend Mal habe ich diese Stadt schon gesehen, im Kino, im Fernsehen. Als ich in Manhattan aus der Metro steige ist es dann aber trotzdem oder vielleicht gerade deshalb beeindruckend, plötzlich in dieser Häuserschlucht zu stehen und auf dem Weg zum Hotel an all den ikonischen Bildern vorbeizulaufen: Dem Waldorf Astoria, dem Chrysler-Building. Angenehm ist es auf jeden Fall, wieder an einem Ort zu sein, den man sich zu Fuß erschließen kann, wo man für eine Distanz von zwei Blocks nicht das Auto nimmt.
Was denken die New Yorker über Trump? – schließlich ist er ja einer von ihnen. Wie kann es sein, dass nicht mal die Medien hier seinen Sieg haben voraussehen können? Aber auch bei den Kolleginnen und Kollegen in NYC herrscht Optimismus vor: „Great times for journalism“. Neben den harten Fakten und Analysen sind es immer mehr die Anekdoten, die einem das Gefühl geben, Stück für Stück etwas besser zu verstehen, was gerade in diesem Land passiert.
Hoboken High School
Ein guter Zeitpunkt für eine Verschnaufpause von der eigenen Branche. In New York haben wir zum Abschluss noch zwei besonders beeindruckende Begegnungen: In einer High School in Hoboken verbringen wir einen Nachmittag mit Schülern, von denen viele aus einfachen Verhältnissen kommen, oftmals aus Migrantenfamilien: Mexiko, Haiti, Dominikanische Republik. Sie zeigen uns ihre Schule und erzählen von ihren Träumen. Die Football-Stars freuen sich auf das College-Stipendium und zeigen uns stolz ihre Promotion-Videos auf Youtube. Andere wollen Krankenschwester oder Anwältin werden. Die jungen Erwachsenen machen sich schon viele Gedanken über ihre Möglichkeiten und ihre berufliche Zukunft. Ihre Schule liegt in einem mittlerweile reichen Bezirk, aber in ihren Familien sind sie oft die ersten, die einen High-School-Abschluss machen.
Raus aus der Blase
Keine Suppenküche, mehr eine Art Restaurant für Menschen ohne Geld. So erklärt uns RIAS-Fellow Bob das Selbstverständis dieses besonderen Projekts. Gemeinsam bereiten wir in der Großküche das Mittagessen vor: Chicken Parmigiana – hat nichts mit Italien zu tun, das ist ein US-amerikanisches Gericht, so Bobs ehrlicher Hinweis. Die Soup Kitchen der St. James Church liegt in einer wohlhabenden Gegend an der New Yorker Upper East Side, nur wenige Blocks vom Central Park. Aber auch hier gibt es viele Menschen, die auf der Straße leben oder sich mit ihrem Einkommen das teure Leben in der Stadt einfach nicht leisten können. Bei den Mietpreisen kein Wunder.
Beim Gespräch mit den Gästen wird schnell deutlich, wie viel schneller man hier durchs soziale Netz fallen kann. Viele der Obdachlosen oder Mittellosen, die hier zum Lunch kommen sind nicht schlecht gekleidet, manche sind politisch gut informiert. Ich unterhalte mich längere Zeit mit einem desillusionierten Veteranen über die Unterschiede zwischen europäischer und US-amerikanischer Sozialpolitik und er erklärt mir seine Sicht auf die Fehler im sozialen Wohnungsbau in New York.
Nach dutzenden Think Tanks und News Stations tut es gut, mit „normalen“ Menschen zu sprechen.
Raus aus der Bubble. Die Frage, die auf der Reise immer wieder kam: Warum haben all die Think Tanks und Journalisten Trump nicht kommen sehen? Bei den Unterhaltungen in St. James wird wieder klar, wie wichtig es ist, raus zu gehen und den Menschen zu zu hören. Denn hier hört man die Geschichten, die einem zeigen, wo es in der Gesellschaft schon seit langem brodelt. Ein mögliches Frühwarnsystem für Journalisten – zumindest wenn man den eigenen Anspruch ernst nimmt: „keep reporting every single day“.
Anja Froehlich, Zweites Deutsches Fernsehen, Mainz
Out of many … one
Das Radio im Taxi säuselt: It started with a kiss … Nun, das wäre dann doch zu romantisch. Ich starte mit einem knapp 9-Stunden-Flug nach Washington. Aber dann gibt es doch die ersten Küsschen: Wir, die RIAS-Truppe, die wir uns bislang nur per whatsapp-Gruppe verständigt hatten, treffen „uns“ face to face: zehn neugierige Journalisten aus Deutschland, voller Vorfreude auf das, was jetzt kommen wird, was uns in „Trump-Country“ erwartet. Schnell wird klar: Uns erwartet eine Menge. Gerade in diesen Zeiten! „You never know what happens on a Saturday morning“. Das war der Lieblingssatz unserer amerikanischen Kollegen. „You never know, what he tweets next“. Präsident Trump liebt es nämlich, am Samstagmorgen die Welt mit neuen kuriosen Botschaften zu beglücken. Und die Journalisten-Kollegen müssen jederzeit bereit sein, darauf zu reagieren.
Aber Washington hatte natürlich noch einiges mehr zu bieten. Wir durften eintauchen in die spannende Welt der Hauptstadt Amerikas: die „think tanks“, die pro- and anti Trumps, die alten, verwirrten Hasen in dieser neuen, obskuren Welt.
From the capital to the countryside … to Spartanburg: Smiling Faces. Beautiful Places. South Carolina — or just call it: GREAT TIME with TC.
Mein Flug von Washington nach Greenville startet ziemlich früh, also aufstehen „Mitten in der Nacht“, zumindest gefühlt nach der von Eindrücken geprägten Woche in Washington. Aber die Herzenswärme, mit der ich dort empfangen werde, macht das mehr als wett. Tommy von 7news, wspa, einem kleinen Privat-Sender in Spartanburg, oder wie mein Host zu sagen pflegte: „Anja, just call me TC“. Tomas Colones steht in seinem Reisedokument.
Er kümmert sich, erklärt, nimmt sich Zeit. Ich habe das Gefühl, zur rechten Zeit am rechten Ort zu sein. Als i-Tüpfelchen gibt’s zur Begrüßung ein „survival package“ mit allerlei Leckereien. Schon sehr früh merke ich: TC trägt sein Herz am rechten Fleck und bis zum Ende der Woche lerne ich: TC tummelt sich fast Zeit seines Lebens in diesem Medien-Business, ja es ist sein Leben. Er ist hervorragend vernetzt, bekannt wie „ein bunter Hund“, äußerst beliebt und wird von allen sehr respektvoll behandelt, egal ob von Kollegen oder Interviewpartnern.
Er ist ein Deutschland-Kenner und stolz darauf, dass sich in Spartanburg etliche deutsche Firmen niedergelassen haben. TC liebt deutsche Autos und zeigt mir gleich zur Akklimatisierung das BMW-Werk in Spartanburg. Wir machen einen Stopp bei „Aldi“ (ja genau, die Feinkostkette aus Deutschland!), studieren die deutschen Produkte und kaufen — ganz wichtig — German Gummibärchen, um uns dann gemeinsam vor einem Beton-Hauch deutscher Geschichte abzulichten: Ein Stück der Berliner Mauer steht in Spartanburg; ein Geschenk der Firma Menzel. „What a piece of history we have in our city. Berlin Wall.“
An „TC’s Day off“ entführt er mich ins wunderschöne Charleston, eine Hafenstadt im U.S.-Bundesstaat South Carolina, etwa drei Autostunden von Spartanburg entfernt. Wir begeben uns auf eine kleine Sightseeing-Tour, essen vorzüglich zu Mittag und treffen Pam, eine Freundin und frühere Moderatorin von Chanel Seven. Wir philosophieren über den Job und das Leben. Was nach einem entspannten Tag klingt, ist am Ende trotzdem intensiv, denn auch diese Eindrücke müssen erst einmal verarbeitet werden.
Back to work heißt es dann am nächsten Tag: Der Alltag hat uns wieder, und dieser Alltag wird hier in Spartanburg bei seven News von Politik, Crime und social life bestimmt. Neue Polizei-Puppies werden vorgestellt. Wir sind natürlich live dabei, interviewen die Puppies oder besser gesagt deren Besitzer, die Police Officer. Die kleinen süßen „Monster“ können noch nicht sehr viel, sind aber extrem neugierig. Dann der Klassiker: Kaum beim Mittagessen rebelliert das Mobiltelefon: Gun shooting. Oh my god. Also auf ins Auto und los. TC ist routiniert, bemerkt, dass mir bei diesem Auftrag nicht so wohl ist. Ich Angsthase bevorzuge es, im Auto zu bleiben, während er seinen Job macht. Ich beobachte aus der Ferne. In einem Problemviertel in Spartanburg gab es einen Nachbarschaftsstreit, nichts Ungewöhnliches, lerne ich. Niemand wurde verletzt, die Polizei regelt alles. Schaulustige säumen das Gebiet. TC meistert den Dreh alleine, doch ansonsten sind wir zwei während dieser Woche unzertrennlich: arbeiten, lachen, philosophieren.
Schön, mit ihm zu erleben, dass Vorurteile immer vorschnell sind: auch er ist nicht der „typische Amerikaner“, so es die überhaupt gibt. Er ist weltoffen, neugierig und bereits mehrere Male in Europa gewesen. Sein Vater sagte einst zu ihm: „Son, you better get a passport and use it“. Und er hat es getan.
Die Tage in Spartanburg verfliegen. Time to say Good Bye, aber nicht Lebewohl. Denn TC und ich bleiben weiterhin in Kontakt, mailen, sind über Facebook aktiv. Ein echter Freund lebt nun in Spartanburg.
Auf nach New York…
Von Greenville über Washington nach New York. Nach insgesamt vier Reisestunden der Touch down in New York. Noch im Flugzeug werde ich Zeuge einer vielsagenden Konversation. Ein Anzugträger telefoniert mit einem Freund. Ich merke mir folgenden Satz: „No. I am in D.C. I will impeach Trump.“ Ich schaue ihn, nur durch den Gang getrennt, an und schmunzle. Er nickt. Wir verstehen uns.
Der Donald: Er ist das alles beherrschende Thema in den Staaten.
Die Tage in New York sind skyscraper-hoch und Big-Macs voll. Und vor allem — lehrreich; United Nations — Eine Welt, eine Rechnung, die aufgemacht wird. CNN — He took office and it was chaos. NBC — We have the world in New York. And Trump! Auch wenn sie kein Interview mehr bekommen…
Ein letzter Kaffee; die Werbung dazu; What do we love even more than coffee? — Our people. Dieses Aroma habe ich am eigenen Leib zu spüren bekommen. Die Herzlichkeit und Hilfsbereitschaft der U.S.-Amerikaner haben mich nicht überrascht, mir dennoch gut getan. Es war eine wundervolle, ereignisreiche und lehrreiche Zeit. Vielen Dank — RIAS!!!
Birgit Hahn, Radio Hamburg, Hamburg
Ich durfte in diesem Frühjahr an dem zweieinhalbwöchigen RIAS Programm mit den Stationen Washington D.C., Eugene in Oregon und New York teilnehmen. Schon im Vorfeld wurde ich von Isabell Hoffmann über alle wichtigen organisatorischen Belange informiert und Jon Ebinger hat ein sehr ausführliches und interessantes Programm zusammengestellt. Das machte schon im Vorfeld sehr neugierig und meine Erwartungen wurden noch übertroffen. Da es nicht möglich ist auf zwei Seiten über alles zu schreiben, habe ich mir von den drei Stationen jeweils meine Höhepunkte herausgesucht, um einen Eindruck zu vermitteln, was dieser Journalistenaustausch alles beinhaltet.
Washington D.C.
Nach dem ersten Kennenlernen mit Jon — bei dem wir noch einmal ausführlich gebrieft wurden- lernten wir gleich am ersten Tag Jeff Mason kennen, den Sprecher der White House Press Conference. Er erzählte uns von der aktuellen Situation in Washington, wie die Presse auf einen Präsidenten Trump reagiert und wie er sich die Zukunft der Presse in den USA vorstellt. Das war ein toller Start. Außerdem erfuhren wir beim PEW Research Institute interessante Insiderinformationen über das Wahlverhalten der Amerikaner. Im Februar 2017 sagen 56 Prozent der Amerikaner, dass der Präsident seinen Job nicht gut macht und sogar 86 Prozent waren der Meinung, dass die Staaten politisch geteilter sind als vor der Wahl. Am nächsten Tag ging es dann zu Families USA, die sich für den Erhalt von Obamacare einsetzen. Denn neben Donald Trump war die Gesundheitsreform das zweite große Thema in Amerika während meines Aufenthaltes. Das wurde in Washington — aber auch während meiner Station Week in Eugene — sehr intensiv diskutiert. Scheinbar hatten sich die Donald Trump Wähler große Hoffnungen auf eine Verbesserung der Krankenversicherung gemacht, mussten dann aber feststellen, dass erst einmal fast 30 Millionen Amerikaner wieder ganz ohne Schutz dastehen würden, gerade in der Altersspanne, die mehrheitlich Trump gewählt hat. In Eugene hat sich deshalb eine Doktorin ganz aus dem Health System rausgezogen, nimmt pro Patient 75 Dollar pro Monat und garantiert ärztliche Betreuung wie es bei uns der Hausarzt übernimmt.
Am Freitag waren wir unter anderem im Headquarter von NPR (National Public Radio) eingeladen. Dort warteten drei Gesprächspartner auf uns, der jeweils aus seinem Fachgebiet berichtete. Den Journalisten dort ist es ganz wichtig durch ständiges Richtigstellen der Fakten dem Meinungsmacherjournalismus etwas entgegenzusetzen. Ihr Motto: Accurate, Fair, Solid. Außerdem hat uns ein Reporter, der fünfzehn Jahre als Präsidentenkorrespondent gearbeitet hat, erzählt, wie es Trump schafft die Massen für sich zu begeistern. Er meinte auch, dass Trump, wenn es ihm gesundheitlich gut geht, noch für eine weitere Amtszeit kandidieren wird.
Kurzfazit: Gerade solche Gespräche mit den Einschätzungen des Profis vor Ort machten das Programm so einmalig.
Station Week Eugene in Oregon
Nach einem 7 stündigen Flug nach Portland und einer zweistündigen Fahrt nach Eugene wurde ich noch am Abend von meinem Host Tracy Berry abends zu einem Dinner eingeladen. Dort hat sie mir einen Überblick über die Radiostation für die sie arbeitet gegeben und die Themen, die gerade in der Stadt aktuell sind.
Am nächsten morgen war ich dann den ersten Tag bei kknu.fm dem erfolgreichsten privaten Radiosender in der Region seit 20 Jahren. Mit einem Musikprogramm das ausschließlich aus New Country besteht. Da ich zur Zeit bei Radio Hamburg in der Morningshow arbeite, war es für mich sehr aufschlussreich zu sehen, wie es bei kknu.fm läuft. Tracy Berry macht dort die Nachrichten und das Wetter, Bill Bennett und Tim Fox sind die Moderatoren. Das Programm läuft montags bis freitags von halb sechs bis neun Uhr und besteht größtenteils aus Talks untereinander oder mit den Hörern. Vorbereitete Moderation gibt es nicht, alles geschieht — außer in den Nachrichten — eher spontan, ist aber doch professionell. Eine redaktionelle Unterstützung ist nicht vorgesehen — weder im Programm noch in den Nachrichten. Ein interessanter Einblick in den Arbeitsalltag, da ich auch beim Privatradio arbeite, aber unsere Ressourcen dann doch ungleich höher sind.
Um mir einen Einblick in die Situation der Bewohner Eugenes zu geben, bin ich nach der Morningshow mit meinem Host Tracy zu mehreren Interviewterminen gefahren. Am eindringlichsten war für mich die Kampagne Family First. Dort kümmern sich meist ehrenamtliche Helfer um obdachlose Familien. Auch das gibt es häufig in den USA. Menschen — zum Teil mit noch sehr kleinen Kindern — die häufig in ihrem Auto leben und bei Family First Hilfe finden, indem sie umsonst einen Computer nutzen können, sie bekommen Unterstützung bei der Job- und Wohnungssuche oder können einfach mal das Bad benutzen und ihre Wäsche umsonst waschen. Das neuste Projekt ist der Umbau einer Kirche als Unterkunft für obdachlose Teenager. Alles finanziert durch Spenden. Das hat mich nachhaltig beeindruckt und mir einen differenzierteren Blick auf die Situation in den USA gegeben. Denn Oregon ist ein recht wohlhabender Staat, wie sieht es dann in den anderen Teilen der USA aus?!
Kurzfazit: Es war toll nicht nur mit Radiokollegen zu sprechen, sondern auch mit Menschen vor Ort, die nichts mit den Medien zu tun haben und sich für eine Sache einsetzen.
New York
Die Woche in New York begann mit einem Besuch der Vereinten Nationen, inklusive Führung und Gespräch mit einem Pressesprecher über seine tägliche Arbeit und wie er mit den täglichen Meldungen aus aller Welt umgeht. Dann durften wir auch noch Bloomberg, CNN und WNBC besuchen und haben dort viele kompetente Gesprächspartner interviewt. Auch hier war das allumfassende Thema: Trump und die Gesundheitsreform. Es war toll und interessant die verschiedenen Einschätzungen der Medienvertreter zu hören, am meisten emotional haben mich aber zwei andere Termine berührt.
Zum einen waren wir in der St James Church in der Upper East Side und haben dort mitgeholfen ein Mittagessen für Bedürftige zu kochen und um das Essen dann auch zu servieren. Jeden Dienstag erscheinen dort etwa 90 Menschen, die entweder auf der Straße leben oder sich kein warmes Essen leisten können. Und mit ihnen über ihr Leben und ihre Sicht der Dinge zu sprechen, war ein Erlebnis, dass ich niemals vergessen werde. Ein Mann, der dort jeden Dienstag isst, war bestens auch über die politische Lage in Europa informiert war, sprach sogar etwas deutsch und sagte zum Schluss. Seit Trump kenne ich ein deutsches Wort mehr: Alpträume.
Zum anderen waren wir kurz vor Ende des Programms in der Hoboken High School in New Jersey und haben uns dort mit Jugendlichem, die kurz vor ihrem Schulabschluss sind, unterhalten. Nachdem sie uns voller Stolz ihre Schule und verschiedene Projekte wie eine Musicalvorstellung gezeigt haben. Sie waren offen und super vorbereitet auf unseren Besuch und sie alle haben große Pläne. Sie wollen Lehrer, Arzt oder Footballprofi werden und auch wenn es bestimmt nicht allen gelingt. Diese Energie und wie sie ihr Leben geplant haben, alleine darüber könnte man schon ein Buch schreiben.
Kurzfazit: Ich habe in New York mit Menschen gesprochen zu denen ich sonst keinen Kontakt hätte herstellen können und das war eine ganz tolle Erfahrung, die nur mit so einem Programm möglich ist.
FAZIT: Dank dieser sehr intensiven und unglaublich lehrreichen zweieinhalb Wochen hat sich mein Blick auf die Situation und die Menschen in den USA verändert und was ich dort an Informationen aus erster Hand bekommen habe, hilft mir auch bei meiner täglichen Arbeit. Dieses Programm ist mehr als zu empfehlen.
Tobias Jobke, Westdeutscher Rundfunk, Köln
Morgengrauen am 9. November 2016. Meine nächtliche Berichterstattung im Deutschlandfunk über die Reaktionen in den Sozialen Netzwerken auf die U.S.-Wahl ist vorüber. Ratlosigkeit macht sich breit. Es ist der Moment, in dem ich seit längerer Zeit wieder an meine RIAS-Bewerbung denke. Wie großartig wäre es, in die USA zu reisen und Experten dort die Fragen zu stellen, die von nun an die Welt bewegen: Wie konnte ein Milliardär gewinnen, der im Wahlkampf mit menschenverachtenden Sprüchen um sich warf? Ist die amerikanische Demokratie wehrhaft genug, dem Präsidenten und seinen Dekreten standzuhalten? Was bedeutet ein U.S.-Präsident, der Reporter aus dem Weißen Haus wirft, für den internationalen Journalismus?
United States of two Americas?
Keine fünf Monate später sitze ich tatsächlich im Flugzeug nach Washington. Da es meine erste Reise in die USA ist, will ich von den Menschen in diesem Land noch so viel mehr erfahren als nur ihre politische Einstellung. Dennoch ist und bleibt die Präsidentschaft Donald Trumps das alles überschattende Thema. Bei unseren Gesprächen in Washington lassen sich erste Puzzleteile möglicher Ursachen erkennen; manche passen schon jetzt, andere fügen sich erst später zusammen. Eine Journalistin des nichtkommerziellen Hörfunk-Netzwerks NPR erläutert uns die Spaltung der Gesellschaft, sie spricht gar von „two Americas“. Eines bestehe aus den vielen Städten, in denen es den meisten Menschen gutgehe — dort, wo es Arbeit und Wohlstand gibt. Das zweite Amerika seien die Orte, an denen sich die Menschen vielfach zurückgelassen fühlten, die „dead parts“ der USA. Noch kann ich mir wenig darunter vorstellen.
Besuch in einem „dead part“ der USA
Doch schon eine Woche später stehe ich einem solchen scheinbar „abgestorbenen Teil“ des Landes: Austin, nicht die prosperierende Hauptstadt von Texas mit ihren 900.000 Einwohnern, sondern eine 5.000-Seelen-Stadt im Bundesstaat Indiana. Ich begleite meine Gastgeberin Barbara Brosher, Redakteurin beim Radio- und TV-Sender WFIU/WTIU in Bloomington, Indiana, und Kameramann Steve Burns. Seit etwa zwei Jahren hat Austin ein verstärktes Drogenproblem, erfahre ich von Barbara Brosher. Inzwischen zieht es sich durch alle Gesellschaftsschichten: Arbeitslose, Lehrer, Anwälte — wer einmal an der Nadel hängt, kommt kaum davon weg. Schwer vorzustellen: Wir fahren an diesem sonnigen Tag durch idyllische Straßen an schönen kleinen Häusern vorbei. Mit einem Mal landen wir in einer Siedlung, in der die Fenster vieler Häuser mit Brettern beschlagen sind — sie scheinen verlassen zu sein. Müll liegt am Straßenrand. Als wir aussteigen, dauert es nicht lange, bis wir die erste Spritze am Boden liegen sehen.
Eine Dosis Euphorie
Wir treffen uns mit Clyde, einem müde aussehenden, etwa 60 Jahre alten Mann, dessen Sohn sich wegen Drogenkonsums einer Therapie unterzogen hat. Clyde berichtet uns, dass in Austin viele Menschen mangels Arbeit Probleme hätten, über die Runden zu kommen. Sie flüchteten sich in Drogen. Angefangen hat es mit dem Schmerzmittel Opana. Nimmt man es über den Mund ein, macht es Schmerzen erträglicher. Wer es sich in die Vene injiziert, verspürt offenbar in kürzester Zeit eine extreme Euphorie. Ein Gefühl, das den meisten Menschen in Austin im nicht berauschten Zustand abhandengekommen ist. Clyde berichtet uns, dass sich auch sein Sohn Kevin immer wieder Opana gespritzt hat. Schließlich erfuhr er beim Arzt, dass er sich mit dem HI-Virus infiziert hat. Wahrscheinlich, weil er die gebrauchte Nadel eines HIV-Infizierten benutzte. In Austin ist das kein Einzelfall.
Stimmen gegen den Stillstand
Ich denke unweigerlich an die Worte einer unserer Gesprächspartner in Washington zurück. Die Wahl Donald Trumps erkläre sich auch aus dem Ärger vieler Amerikaner, die sich abgehängt fühlen. Trump habe das Narrativ vom „dying blue-collar-job“ bedient, vom aussterbenden Arbeiterberuf. Opposition gegen Hillary Clinton sei bei der Wahl Trumps ein wichtiger Faktor gewesen. In den Augen vieler verkörpere die Demokratin den Stillstand. Das bestätigen uns auch Soziologen und Religionsforscher — und illustrieren dies mit Zahlen: 60 Prozent der weißen Katholiken haben demnach für Trump gestimmt, nur 37 Prozent für Clinton. Ihrem Wahlkampfteam sei ein Strategiefehler unterlaufen: Man habe es versäumt, mit der Kampagne mehr Menschen dieser ethnisch-religiösen Gruppe anzusprechen.
Die Kinder nicht an einem dunklen Ort aufwachsen lassen
Nach dem Interview mit dem Vater treffen wir auf zwei junge Männer, geschätzt Anfang 20. Barbara Brosher fragt sie, ob sie zu einem Interview bereit sind. Nur wenn das Gesicht nicht zu erkennen ist, entgegnen die Männer. Dann lassen sie uns doch ihre Gesichter filmen und klagen uns ihr ganzes Leid. Mehrere gute Freunde aus Austin seien schon an ihrer Drogensucht gestorben, erzählt uns der bunt tätowierte Mann mit gesenktem Blick. Freunde, die für ihn wie Familie gewesen seien. Er wolle nicht, dass seine Kinder an solch einem dunklen Ort aufwachsen. Der Mann erzählt uns, dass er als Mechaniker zu den wenigen gehöre, die noch Arbeit haben. 1.000 Dollar habe er angespart und hin und her überlegt, in Austin alles hinzuschmeißen. Doch in einer größeren Stadt könne er damit höchstens einen Monat überleben. Also sei er geblieben.
Trump ist nicht länger CEO
Mit diesen Eindrücken fahren wir zurück nach Bloomington, eine liberale, internationale Studentenstadt. Anders als im großen Rest von Indiana muss man Trump-Wähler hier suchen wie die Nadel im Heuhaufen. Denn auch an Bloomingtons Indiana University machen sich viele Menschen Gedanken über den neuen Präsidenten. Ich komme ins Gespräch mit einem Mitarbeiter, der mehrere internationale Studiengänge betreut. Er ist besorgt, dass die neue Regierung die Finanzierung einschränken könnte. Auch er erklärt, dass Trump in Indiana nur gewählt worden ist, weil Hillary Clinton unerwünscht gewesen sei. Trump müsse nun lernen, dass er nicht länger als Boss einer großen Firma Entscheidungen im Alleingang durchdrücken könne. Nicht nur die Hoffnungen dieses Amerikaners liegen auf den ausgleichenden Kräften von Supreme Court und Kongress.
„Wo ist Mike Pence jetzt?“
In Washington wurde während meiner Stationswoche in Bloomington über den Gesetzesentwurf für Trumps umstrittene Gesundheitsreform beraten. Das drohende Aus für „Obamacare“ beschäftigt auch die Menschen im republikanisch geprägten Indiana. Wir besuchen einen Pressetermin mit dem demokratischen Senator Tim Lanane, der in aller Frühe einer Hand voll Reportern Rede und Antwort steht. Lanane warnt vor fatalen Konsequenzen einer Abschaffung von Obamacare vor allem für Kinder und Senioren in Indiana. „Wo ist Mike Pence jetzt?“ fragt einer aus der Entourage des Demokraten und wirft dem republikanischen Ex-Gouverneur von Indiana und amtierenden Vizepräsidenten vor, seinen Bundesstaat vergessen zu haben. Am Abend des nächsten Tages zieht Trump sein umstrittenes Gesetz überraschend zurück. Er verwickelt sich in Widersprüche, behauptet die Demokraten seien schuld, er habe Obamacare niemals abschaffen wollen.
Jeden Tag neue Fakten
Es ist eine der Aussagen Trumps, die Journalisten schnell verifizieren sollten und bei denen sie hartnäckig bleiben müssen. Ein Reporter des TV-Senders ABCNews, der Trump im Wahlkampf begleitet hat, nannte den Präsidenten im Gespräch mit uns einen „master manipulator“. „Wir werden Fakten liefern, bis die Menschen sagen, wir können das nicht mehr ignorieren,“ ist die Antwort der NPR-Journalistin auf Trumps bisweilen flexible Vorstellung von Wahrheit. Ihr Mantra: „Ich werde jeden Tag von Neuem aufstehen und Fakten präsentieren.“ Sie konstatiert, dass sich auch die U.S.-Bürger aufgrund sozialer Netzwerke wie Facebook zunehmend in ihren eigenen Informationsblasen aufhielten. Nur seien diese Blasen inzwischen zu Betonbunkern ausgehärtet, ein Wechsel der Perspektive für viele schwierig.
Die Story einer Journalisten-Generation
Aber die Journalisten, mit denen wir gesprochen haben, sehen dieses Gefüge eher als Ansporn denn als Grund zur Resignation. Wir lernen, das Interesse am Journalismus sei gewachsen — seit der U.S.-Wahl im Allgemeinen, aber auch seitdem die Trump-Regierung zwischen Fakten und sogenannten alternativen Fakten unterscheidet. Laut der NPR-Reporterin hat das dazu geführt, dass sich die Menschen wieder verstärkt dem Journalismus zuwenden, auf der Suche nach Bestätigung von Informationen. Bei WTIU/WFIU in Bloomington spricht man sogar von einem regelrechten „Trump-Bump“, Hörer- und Zuschauerzahlen seien auf einem höheren Niveau als nach dem 11. September. Trump sei „die Story einer ganzen Generation von Journalisten“, resümiert begeistert der ABCNews-Reporter. Endlich können sich die Medien wieder in ihrer Kerndisziplin beweisen: Missstände aufdecken, die vierte Gewalt im Staat sein. Allerdings räumen die meisten unserer Gesprächspartner ein, dass die Geschwindigkeit, mit der aus einem Trump-Tweet eine Nachricht, aus einem Trump-Tadel ein Lob werden kann, Neuland für sie ist.
„Ein Land, das eigentlich nur geliebt werden will“
Auf den Punkt bringt es die Mitarbeiterin eines großen Forschungsinstituts in Washington, eine Deutsche, die seit rund zehn Jahren in den USA lebt. Während sie einen Laptop an den Beamer anschließt, analysiert sie fast beiläufig, aber in meinen Augen sehr treffend: „Die USA — ein großes Land, das vor allem mit sich selbst beschäftigt ist, aber eigentlich nur geliebt werden will.“ Und das fällt angesichts der Gastfreundschaft, die einem überall entgegenschlägt, nicht schwer. In Washington kommt am Metro-Automaten sofort ein freundlicher Mitarbeiter auf mich zu und hilft mir, das richtige Ticket zu lösen. Wir kommen ins Gespräch, er war zuletzt vor sieben Jahren in Deutschland, wir verabschieden uns mit einem herzlichen Händedruck. In Bloomington empfängt mich Barbara Brosher mit einem Barbecue in ihrem Garten, den letzten Abend verbringen wir mit einem Großteil der Redaktion bei amerikanischem Bier und deutschen Jägermeister-Shots. Im New Yorker 9/11-Memorial unterhalte ich mich mit Museumsmitarbeiter Oscar, einem Einwanderer aus Kolumbien, über amerikanische und europäische Politik. Das Klischee vom unwissenden U.S.-Amerikaner, der Deutschland immer noch unter der Nazi-Herrschaft vermutet, werde ich nach meinem ersten USA-Aufenthalt jedenfalls auch weiter im Reich der Klischees verorten. Meine Ratlosigkeit nach der Wahlnacht ist der Zuversicht gewichen, dass die Mehrheit der Menschen in den USA das Beste aus der Präsidentschaft von Donald Trump machen und ihre Schlüsse daraus ziehen wird.
Mir bleibt am Ende nur ein großes Dankeschön an die RIAS-Kommission und an alle Mitarbeiter für die eindrucksvollen drei Wochen! Und ein nicht weniger großer Dank gilt meinen RIAS-Fellows, die die Reise zu einem unvergesslichen Gruppenerlebnis werden ließen.
Selina Koc, ARD, Hamburg
+++ WINTER STRIKES BACK (WTOP, 12.3.17) +++
„Willkommen in Washington D.C.! Die Temperatur liegt aktuell bei minus drei Grad. Die Westküste bereitet sich gerade auf einen schweren Schneesturm vor. Wir empfehlen Ihnen dringend, sich schnellstmöglich in Ihre Unterkunft zu begeben.“ Zugegeben, die Ansage unseres Flugkapitäns macht nicht gerade große Lust auszusteigen, aber die Vorfreude auf das RIAS-Abenteuer überwiegt dann doch. Ich schalte mein Telefon ein. Unzählige Eilmeldungen ploppen auf: „USA-Reise der Kanzlerin kurzfristig abgesagt,“ steht da oder „Schneesturm: Merkels Treffen mit Trump verschoben.“ Auf Twitter wird der abgesagte Flug bereits hämisch kommentiert: „Merkel wollte mit Trump über den Klimawandel sprechen,“ schreibt ein Nutzer. „Jetzt reden sie übers Wetter. Punkt für Donald.“ Ich muss lachen.
53 Tage ist Donald Trump bei meiner Ankunft in Washington schon Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika und irgendwie kann ich es immer noch nicht so ganz glauben. Warum haben ihn die Menschen gewählt? Was halten die Amerikaner von ihrem neuen Präsidenten? Zieht er „America First“ wirklich durch? Und vor allem: Wie hat sich die Arbeit der Journalisten in Zeiten von „Fake-News-Beschimpfungen“ und „Alternativen Fakten“ verändert? In den kommenden drei Wochen werde ich die Gelegenheit bekommen, alle meine Fragen zu stellen.
Eine unserer ersten Stationen in Washington D.C. ist das Meinungsforschungsinstitut „Pew Research Center“. Hier versucht man mit bunten Linien- und Balkendiagrammen dem Trump-Wähler eine Identität zu geben. Wir lernen, dass viele seiner Anhänger enttäuscht sind von der sogenannten etablierten Politik; sie fühlen sich abgehängt. „81 Prozent der befragten Trump-Anhänger sind der Meinung, dass es den Amerikanern heute schlechter geht als noch vor 50 Jahren,“ erklärt Carroll Doherty. Er leitet die Abteilung Politikforschung. Bei den Anhängern von Clinton sähen das dagegen nur 19 Prozent so. „Die Menschen, die für Trump gestimmt haben, wollten vor allem eins,“ resümiert Doherty: „Mit Trump neue Wege gehen, auch wenn hinterher alles noch viel schlimmer kommt.“ Sein Kollege Gregory A. Smith sagt: Für viele U.S.-Amerikaner habe es einen entscheidenden Grund gegeben, für Trump zu stimmen: „Because he is not Hillary Clinton.“
+++ IN MAJOR DEFEAT FOR TRUMP, PUSH TO REPEAL HEALTH LAW FAILS (NYT, 24.3.2017) +++
Andere beschäftigen sich zu diesem Zeitpunkt bereits mit den möglichen Folgen von Trumps politischen Plänen. Zum Beispiel Molly Reynolds von der renommierten „Brookings Institution“. Ihr Arbeitgeber ist eine der ersten Anlaufstellen für die Rat suchende Öffentlichkeit in politischen Fragen. „Der Präsident hat bei der vergangenen Wahl eine ziemlich große Macht bekommen,“ erklärt Reynolds. „Denn die Republikaner haben die Mehrheit im Senat und im Repräsentantenhaus.“ Trotzdem müsse man erst mal abwarten, ob er seine Gesetze wirklich durchbekommt. Wenn die Republikaner nicht an einem Strang zögen, könnte es schwierig werden. Die Steuer- und die Gesundheitsreform seien deshalb wichtige Gradmesser. Sie würden zeigen, wie geschlossen die Republikaner hinter ihrem Präsidenten stehen. Nur wenige Tage nach unserem Besuch wird die erste Abstimmung über Trumps Gesundheitsreform abgesagt. Wegen mangelnder Aussicht auf ausreichende Stimmen haben die Republikaner im Repräsentantenhaus ihr Gesetz zurückgezogen.
Diese Nachricht dürfte vor allem bei der Organisation „Families USA“ für kurzfristige Erleichterung gesorgt haben. Seit Trump zum neuen U.S.-Präsidenten gewählt wurde, stehen die Telefone nicht mehr still. Die Organisation vertritt die Interessen von Verbrauchern im Gesundheitswesen und setzt sich für eine bessere Gesundheitsvorsorge ein. Viele Menschen hätten Sorge, ihre Krankenversicherung zu verlieren, berichten uns die Mitarbeiter. Unbegründet sind diese Ängste nicht. Gerade erst sind aktuelle Zahlen bekannt geworden. Demnach könnten im Falle der Abschaffung von Obamacare in den kommenden zehn Jahren etwa 24 Millionen U.S.-Bürger ihre Krankenversicherung verlieren.
Was es bedeutet, nicht krankenversichert zu sein, erlebe ich eine Woche später in Atlanta. Ich mache dort meine Station Week bei CNN und brauche Ersatz für ein verloren gegangenes Medikament. Ohne amerikanische Krankenversicherung werde ich von mehreren Ärzten abgewiesen. Meine amerikanischen Kollegen empfehlen mir ein Fachärztezentrum. Hier kann man sich auch ohne Versicherungsschutz behandeln lassen. „No Weapons allowed“ steht an der Eingangstür. Drinnen gibt es Sicherheitspersonal und Überwachungskameras. Ich fühle mich unwohl, aber immerhin erklärt sich der Arzt bereit, mir das benötigte Rezept auszustellen. Allerdings nur gegen Vorleistung: 150 (!!!) Dollar muss ich bezahlen, bevor ich überhaupt im Wartezimmer Platz nehmen darf. Das Geld bekomme ich später von meiner Auslandskrankenversicherung zurück. Aber mir wird klar: Krank sein muss man sich in den USA erst mal leisten können — ein Rezept auch.
+++ TRUMP BUDGET CALLS FOR ELIMINATION OF DOZENS OF FEDERAL PROGRAMS (NBC, 16.3.2017) +++
Neben dem Arztbesuch lieferte das Praktikum bei CNN natürlich auch interessante Einblicke in die journalistische Arbeitswelt der USA. Hauptgesprächsthema während und nach der Arbeit: der neue U.S.Präsident. Einiges habe sich verändert, erzählen die Mitarbeiter des Nachrichtensenders, der von Trump öffentlich als „Fake News“ und „Feind des amerikanischen Volkes“ beschimpft wurde. „Wir versuchen mehr Fakten zu liefern und möglichst viele Belege für unsere Informationen in den Berichten unterzubringen,“ sagt einer der sogenannten Script Editors. Er ist in dem großen Newsroom für die Abnahme von Reporter-Beiträgen zuständig. Wie andere Medienhäuser in den USA, hat auch CNN sein Team verstärkt, seit Trump U.S.-Präsident ist. Besonders an den Wochenenden und am Abend. Denn der neue Mann im Weißen Haus hält sich nicht an die üblichen politischen Geschäftszeiten. „Er twittert, wann immer ihm etwas durch den Kopf geht,“ amüsieren sich die Kollegen beim Mittagessen. „Wir müssen jederzeit damit rechnen, dass er mit einer neuen Twitter-Botschaft für Turbulenzen sorgt.“
Diese Erfahrung kennen auch die Hauptstadt-Journalisten in Washington. Fast alle die wir treffen klagen darüber, dass sich der Zugang zu Informationen verschlechtert habe. Akkreditierungen oder Interviews seien schwer oder gar nicht zu bekommen. Rechtskonservative Medien wie „Breitbart“ oder „Fox News“ würden bevorzugt. Anne Gearan ist bei der „Washington Post“ seit Jahren für das Außenpolitik-Ressort zuständig. Mit den früheren Außenministern Kerry und Clinton ging sie oft auf Reisen. Von ihrem Nachfolger Tillerson hat sie persönlich noch kein Interview bekommen. Kritische Presse hat er auf seinen Reisen nicht gern dabei. Und so müssen ihm die Journalisten mit Linienflugzeugen hinterherreisen, um überhaupt an Bilder oder möglicherweise ein Interview zu kommen.
Statt den News hinterherzujagen, setzt der öffentliche Radiosender NPR auf investigativen Journalismus. Hier hofft man auf ein zweites „Watergate“, um den Präsidenten zu stoppen. Fünf Reporter arbeiten ausschließlich daran, die Interessenkonflikte des Präsidenten aufzudecken. Wie lange die Journalisten das noch können ist allerdings unklar. Denn Trump hat angekündigt, die Mittel für den öffentlichen Rundfunk ersatzlos zu streichen.
+++ GERMANY REACTS TO MERKEL-TRUMP VISIT: ‘COULD HAVE BEEN A LOT WORSE’ (NYT 18.3.2017) +++
Wie schwierig das Verhältnis zwischen dem U.S.-Präsidenten und den amerikanischen Medien ist, zeigt sich dann auch bei der gemeinsamen Pressekonferenz von Trump und Merkel anlässlich ihres USA-Besuchs. Dort stellte Kristina Dunz von der Deutschen Presse-Agentur eine Frage, die sich ihre U.S.-Kollegen offenbar nicht zu stellen trauten: „Warum macht Ihnen Pressevielfalt so große Angst, dass Sie so oft von ‚Fake News‘ sprechen und selbst Dinge behaupten, die dann nicht belegt werden können — wie die Äußerung, Obama habe Sie abhören lassen?“ Eine Antwort bekam Kristina Dunz nicht, aber für die Frage wurde sie von ihren amerikanischen Kollegen auf Twitter gefeiert. So schrieb der Washington-Korrespondent der New York Times: „Ein Mitglied der deutschen Journalistengruppe stellt endlich die Frage nach der Abhöraktion.“ Und CNN-Politik-Korrespondent David M. Drucker twitterte: „Gute Arbeit der deutschen Presse. Ernsthaft.“
Als ich abends einen Hot-Dog-Verkäufer nach dem Weg frage, fragt er mich: „Woher kommst du?“ „Aus Deutschland,“ antworte ich. Wir quatschen ein paar Minuten über die Gründe für meine USA-Reise, über Medien, Politik und den neuen Präsidenten. „Ihr habt so ein Glück,“ sagt er. „Ihr werdet von einer intelligenten Frau regiert, die gute Manieren hat und ein Herz für Menschen in Not. Unser Präsident ist ein Clown, der nur seine eigenen Interessen im Blick hat. Ich weiß nicht, was aus diesem Land noch werden soll.“
Die U.S.-Amerikaner werden mit der Politik von Donald Trump in den kommenden Jahren leben müssen. Bald steht die 100-Tage-Bilanz an. Die U.S.-Medien sollten dann auch mal selbstkritisch Bilanz ziehen. Setzen sie sich hart genug gegen die vom Weißen Haus auferlegten Restriktionen zur Wehr? Haben Sie die richtigen Konzepte? Viele Medienhäuser haben auf Trumps „Fake-News-Angriffe“ mit einer Qualitätsoffensive reagiert: Sie haben die Zahl ihrer Korrespondenten aufgestockt, ihre Investigativ-Abteilungen ausgebaut und zusätzliche Fakten-Checker eingestellt. Dem Journalismus tut das sicherlich gut. Doch es fehlt an einer Strategie gegen die mediale Abschottungspolitik des Präsidenten. Und meiner Meinung nach: auch an mehr Mut.
Arne Orgassa, Westdeutscher Rundfunk, Köln
Die turbulenten Staaten von Amerika
Wo ist die verdammte Tüte? Panik macht sich im fahlen Gesicht meiner Sitznachbarin breit, während sie hektisch die Sitztasche vor sich durchwühlt. Wir sind im Landeanflug auf Washington Dulles, wobei das Ganze mehr einer Achterbahnfahrt gleicht. Draußen tobt der angekündigte Wintersturm, viele Maschinen wurden bereits umgeleitet – unsere nicht. Das Flugzeug sackt immer wieder ab, neigt sich erschreckend weit nach rechts oder links. Es geht – sprichwörtlich – turbulent zu. Irgendwie passend, wie Washington uns RIAS-Fellows empfängt.
Seit rund 60 Tagen ist Donald Trump nun in Amt und Würden. Kein Tag ist seither vergangen, an dem er und sein Team die Welt nicht mit der turbulenten Amtsführung oder unkonventionellen Tweets überrascht oder gar überrumpelt haben: Klimawandel – eine Erfindung hysterischer Wissenschaftler, Freiheitsrechte – ja, aber bitte nicht für jeden, „Fake News“ – machen nur die anderen, Obamacare – „repeal and replace“, sofort! Die politische Debatte ist rüde und unversöhnlich geworden in den Staaten.
Und während der oberste „Top-Deal-Maker“ der Nation von einem Teil der Amerikaner für die neuen Töne aus Washington gefeiert wird, findet es der andere Teil eher wie meine Sitznachbarin: zum Kotzen. Glücklicherweise hatte sie rechtzeitig die Papiertüte gefunden.
Die aufwachenden Staaten von Amerika
„Die Menschen, die für Trump gestimmt haben, wollen vor allem eins“, resümiert Carroll Doherty. „Mit Trump neue Wege gehen, auch wenn hinterher alles noch viel schlimmer kommt.“ Hauptsache nicht Hillary Clinton, Hauptsache gegen das Establishment, Hauptsache anders. Nüchtern erklären er und seine Kolleg*Innen vom Pew Research Centre mit Hilfe von unzähligen Balkendiagramme und Tabellen den Wahlerfolg Donald Trumps.
So schonungslos sind die anderen, meist liberal gesinnten Gesprächspartner in der „Washingtoner-Blase“ vor uns zehn RIAS-Fellows nicht in ihrer Analyse. Egal ob Politiker, Berater, NGO-Mitarbeiter oder Journalist, die Woche in Washington zeigt: Die Schockstarre hat die Hauptstadt zwar hinter sich gelassen, aber die Analyse, warum das schier Undenkbare eingetreten ist, fängt gerade erst an.
Da muss in den letzten Jahren oder sogar Jahrzehnten etwas gehörig schief gelaufen sein, heißt es. Vor allem die Spaltung in die „rich cities“ und die „dead parts“, in denen sich die Menschen zurückgelassen und nicht verstanden fühlten, sei unterschätzt worden – auch wenn dies nur eine vereinfachende Darstellung der Umstände sei. Und dann, meist gegen Ende der Gespräche, blitzt da immer mal wieder etwas auf, ein Anflug von Selbstkritik: Diese abgehobene „Washingtoner-Blase“, das Partei-Establishment und die gut situierten Intellektuellen hier, all‘ das könnte vielleicht selbst ein großer Teil des Problems sein. Nur was dagegen tun? Die Antwort bleibt aus.
Die gespaltenen Staaten von Amerika
Rund 1000 Meilen liegen zwischen Washington DC und Fayetteville in Arkansas. Ein kleines beschauliches Städtchen im Bible Belt, amerikanische Provinz, nichts Weltstädtisches. Und doch entspricht hier überhaupt nichts dem Klischee, das dieser Region anhaftet.
Die University of Arkansas bestimmt den Takt der Stadt: Viele Studenten, liberale, progressive Ansichten, eine bunte, alternative Kneipenszene und ein kollektives Entsetzen über Präsident Trump. Selbst Aufkleber mit dem Schriftzug „No Guns“ sind hier und da zu sehen.
Vor den Toren der Stadt tritt dann das erwartete Klischee ein. Dort auf dem Land lebt die konservative, religiöse Bevölkerung. Dicke SUVs und Trucks stehen vor großen Häusern, an denen sichtbar der Zahn der Zeit nagt. Fremde werden erstmal kritisch beäugt. Trotzdem werden auf Wunsch mit großem Enthusiasmus die eigenen Waffen präsentiert. Hier ist Trump-Land, hier wohnen die „Washington-Hasser“, denen schon die liberalen Menschen im wenige Kilometer entfernten Fayetteville suspekt sind.
Der Bruch Amerikas verläuft hier gut sichtbar entlang der Stadtgrenze.
Shanda Hunter weiß das nur zu gut. Sie ist Chefredakteurin bei 5News, einer der drei kommerziellen TV-Stationen. Mehrmals am Tag versorgt der Sender die Region mit Nachrichten: Viel Wetter, ein wenig Crime und Verkehrsunfälle, gerne Herzerwärmendes und Buntes – Politik, nur wenn es wirklich sein muss.
„Ich bin Journalisten, natürlich würde ich gerne mehr harte News bringen und über Trumps Politik sowie die Auswirkung für unsere Region berichten, aber das funktioniert hier nicht“, sagt sie resigniert. Es sei egal, was sie über Trump senden würden. „Entweder werfen uns die Liberalen in der Stadt vor, nicht kritisch genug zu sein, oder die Konservativen auf dem Land schreien laut Fake News.“ Trump polarisiere und das koste uns am Ende nur Einschaltquoten. Und fallende Quoten sind natürlich schlecht fürs Geschäft.
Ein Regionalsender, der politische Berichterstattung über Trump weitestgehend ausblendet, da neutrale Informationen und ein Anstoß zur politischen Debatte in der Bevölkerung nicht erwünscht sind. Wie sagten sie im fernen Washington: Irgendwas müsse gehörig schief laufen. Stimmt.
Die satirischen Staaten von Amerika
Es geht zurück an die Ostküste, in die Stadt, die niemals schläft und über die Liza Minelli einst sang: „Wenn Du es hier schaffst, dann schaffst Du es überall.“ Diesmal haben es die New Yorker nicht geschafft. Auch wenn fast 80 Prozent ihre Stimme Hillary Clinton gaben, sie konnten Donald Trump nicht verhindern. Seither wird Protest geübt. Lautstark will das liberale New York der rechten Revolution trotzen, will seinem Namen als freizügige, aufgeschlossene und weltoffene Hochburg alle Ehre machen.
An vorderster Front mit dabei – zwar nicht auf der Straße dafür jeden Abend im Fernsehen – die Late Night Talker der Stadt. Ob Stephan Colbert mit seiner „Late Show“ auf CBS, „Full Frontal“ mit Samantha Bee auf TBS oder die „Daily Show“ mit Trevor Noah auf Comedy Central – sie alle arbeiten sich am neuen Präsidenten ab und das vor einem Millionenpublikum. Und wir RIAS-Fellows sind live dabei.
Ein kleines TV-Studio am Rande von Hells Kitchen. In wenigen Minuten beginnt die Aufzeichnung der aktuellen Folge „The Daily Show“. Trevor Noah schäkert noch kurz mit dem Publikum, nimmt hinter seinem Schreibtisch Platz, dann startet das Intro.
Die Show beginnt mit einer achtminütigen Demontage von Trumps Energiepolitik und Kohleobsession. Es ist verdammt lustig – aber viel wichtiger: Es ist eine achtminütige Unterrichtseinheit über den Zusammenhang von Arbeitsplätzen, dem Bedeutungsverlust von Kohleenergie und globaler Energiepolitik. Gut recherchiert, gespickt mit Zitaten und Belegen, auf unterhaltsame und anschauliche Weise präsentiert.
Was Nachrichten wie 5News nicht machen, Politik einordnen und erklären, Sachverhalte in Frage stellen sowie kritisch analysieren, übernehmen also die Satiriker des Landes – in Comedy-Shows mit starkem liberalen Einschlag.
Es beruhigt natürlich zu wissen, dass solche Sendungen versuchen, Zusammenhänge zu erklären und einen Beitrag zur politischen Meinungsbildung zu leisten – also die Lücke schließen, die die kleinen und großen Nachrichtenformate hinterlassen haben. Doch ist das die Lösung für eine Wiederbelebung des politischen Diskurses, gar einer Umkehrung der Spaltung des Landes?
Eher nicht! Auch Trevor Noah und seinem Team an diesem Abend wieder alles geben und 30 Minuten sehr intelligente Unterhaltung bieten – ihre Show wird am Ende doch nur vom liberalen Spektrum des Landes gesehen – also mehr Fayetteville Stadt als Umgebung. Und so bleibt nach den drei Wochen RIAS-Programm der ernüchternde Eindruck zurück, dass die Vereinigten Staaten von Amerika weiter auseinanderdriften.
Es ist noch viel zu tun für die etwas ratlosen Politiker, Berater oder Journalisten in Washington – und im ganzen Land.
Judith Schacht, ARD, München
Klare Sicht mit der U.S.-Brille
“Amerika — damit kenne ich mich aus”, dachte ich vor meiner RIAS-Reise. In Deutschland wird — auch wegen Donald Trump — in den letzten Monaten mindestens genauso viel über das amerikanische Politgeschehen berichtet wie über das deutsche. Außerdem war ich schon einige Male dort; im Urlaub, aber auch zu Gast bei einer Familie.
„Amerika — ist zu vielfältig und zu groß, um sich damit auszukennen,” das denke ich jetzt nach meiner RIAS-Reise. Obwohl ich jetzt eigentlich viel mehr weiß. Vor allem ist mir jetzt klar, dass ich die Dinge, die in Amerika passieren, die Dinge, die Amerikaner tun, allzu oft mit meiner deutschen Logik bewerte und betrachte. Doch es gibt auch eine amerikanische, die U.S.-Weltsicht-Brille. Die ist weder besser noch schlechter als die deutsche — mit Sicherheit aber ganz anders.
Bei der RIAS-Reise konnte ich zahlreiche spannende Personen treffen. Es waren in drei Wochen so viele wie man sonst in einem Jahr trifft. Alle sprachen ungewöhnlich offen zu uns, gaben uns Raum und Zeit. So geballt erlebt man das selten. Aus all den Personen möchte ich zwei auswählen und beschreiben, die mich am meisten erstaunt, inspiriert oder irritiert haben. Über sie musste ich im Nachhinein noch länger nachdenken. Ich ahne, dass eine Ursache dafür der Unterschied zwischen der deutschen und der amerikanischen Logik ist, die andere Brille.
Caroline
„Klar, kannst Du mitkommen.” Sie lächelt, Make-up perfekt. Auf den Beinen und im Einsatz ist sie schon seit drei Stunden. Caroline ist Reporterin bei KCTV5. Für die Morgenshow hat sie schon ein Livestück gemacht — Nachklapp zu einem Brand in einem guten Wohnviertel. Jetzt schlägt sie in der Konferenz ein neues Thema vor, für die Abendnews, mehrere wichtige Shows: „Kann Wasser knapp werden bei einem Großbrand?” Caroline recherchiert, telefoniert. Alles da. Wir können los. Fahren aber nicht. Denn da kommt der Chef mit einer Planänderung. Der Polizeichef von Kansas City hat via Twitter seinen Rücktritt bekannt gegeben. Caroline telefoniert, recherchiert wieder. Wer spricht jetzt mit ihr? Schnell muss es gehen. Wir fahren los. Ein Abgeordneter gibt uns ein Interview. 10 Minuten hat er Zeit. Caroline ist schnell. Kamera, Stativ — sie schleppt, dreht und macht den Ton selbst. Drei Fragen, muss reichen. Ein paar Beautyshots. Wir warten auf den Rückruf des nächsten Interviewpartners. Stressig? Sie habe sich daran gewöhnt, meint Caroline. Zwei Live-Stücke am Tage sei schon viel. Das habe der Chef vor zwei Monaten neu eingeführt. Von acht Uhr morgens bis sieben Uhr Abends ist sie schon meistens unterwegs. Aber Journalistin sein, das findet sie wichtig, gerade in diesen Zeiten. Wirklich wichtig. Den Preis dafür zahlt sie eben. Ob ich das könnte?
Eigentlich hat Caroline geschrieben, längere Geschichten. Hintergrundrecherchen — Zeit und Ruhe. Dann kam die große Medienkrise. Ihre Kollegen und sie verloren ihre Jobs. Caroline hat nicht lange überlegt und sich eine Kamera besorgt. Hat sich selbst beigebracht zu drehen und geübt als Live-Reporter vor der Kamera zu funktionieren. Sie hat versucht zu überleben. Deshalb ist sie auch zurück zu ihren Eltern nach Kansas City. Es ist hart, aber sie ist stolz, dass sie es alles schafft. Dass sie sich im Studio gegen die Konkurrenz behaupten kann. „Jahrelang kann man das wohl nicht machen,” gibt sie zu. Auslandskorrespondentin in einem EU-Land, das wäre sie gerne. Auch weil es dann vielleicht entspannter wäre, glaubt sie. In vier Tagen wird die 30. Gefällt ihr nicht so ganz. Ehe und Familie, darüber hat sie gar keine Zeit nachzudenken. Immerhin: „Feiern mit Freunden, ab und zu.” Und durchhalten — bis… Ja, bis wann eigentlich?
Caroline hat mich beeindruckt, weil sie kämpft, sich mit viel Engagement selbst managen kann. Ich bin mir nicht sicher, ob ich mir auch eine Kamera geschnappt hätte und einfach mal geübt hätte. Dieser Optimismus und das Talent sich zu verkaufen, das man den Amerikanern nachsagt, gibt es offenbar wirklich — Caroline ist ein Beispiel. Aber sie muss auch einiges wegstecken. Zwar ist Caroline im Gegensatz zu mir festangestellt, jedoch ist ihr Pensum und auch ihr Konkurrenzdruck um einiges höher als bei mir. Sie beschwert sich nicht darüber. Vielleicht auch, weil sie nicht weiß, wie es ist, wenn es sicherer ist. Das denke ich, weil ich deutsch bin und ja auch nicht verstehen kann, wie man sich gegen Healthcare wehren kann.
Molly
Wortkarg ist sie. Die Fragen muss ich stellen. Dann kommt eine Antwort, die mehr oder weniger Preis gibt. Hätte ich nicht gedacht, als ich mich Molly vorstelle, denn die sehr gepflegte Frau zwischen 40 und 50 Jahren lächelt — eigentlich immer. Molly kommt seit 19 Jahren am Dienstag hier in die Kirche mitten in Manhattan, um ein Mittagessen für Bedürftige zu kochen. Das ist ihr wichtig, die Gemeinde ist ihr wichtig. Der Dienstag ist nicht der einzige Tag, den sie hier verbringt. Nein, sie arbeite nicht, sagt sie. Auf meine Frage nach ihrem Beruf, fragt sie mich, ob ich meinen Beruf mag. Als ich später nochmal frage, weicht sie mir wieder aus. Ich erfahre noch, dass sie eine Tochter hat und hier in der reichen Gegend um die Ecke wohnt. Immer schon. Mehr aber nicht. Zumindest mir gegenüber, einer Fremden, gibt sie nicht gerne etwas preis. Das merke ich.
In New York zu leben gefällt ihr, weil es immer was Neues gibt, immer etwas Inspirierendes. Trotzdem ist ihr die Beständigkeit wichtig, oder gerade deshalb: Weil es hier immer etwas Neues gibt und ständig neue Menschen kommen. Ihre Freunde habe sie hier in der Gemeinde, sagt sie, oder die Leute in ihrem Haus. Ich erzähle ihr, dass vielen Menschen in Deutschland Religion gar nicht mehr so wichtig ist. Sie sagt, dass sie sich eine Leben ohne die Gemeinde gar nicht vorstellen kann. Was ihr am Glauben am wichtigsten ist? Bei dieser Frage weicht Molly wieder aus und will wissen, wie teuer das Leben in München ist. Dabei lächelt sie.
Über Molly habe ich noch lange nachgedacht. Nicht nur an ihrem Beispiel ist mir klar geworden, wie sehr sich die Rolle von Religion sich in Deutschland und Amerika unterscheiden. Bei uns in Deutschland ist es sehr oft etwas sehr persönliches und individuelles. Ein Gedankengerüst aufgrund dessen man Entscheidungen trifft, dass einem bei Entscheidungen hilft. Es muss nicht unbedingt etwas sein, dass man nach außen trägt oder das man teilt. In Amerika, so ist mein Eindruck, steht der soziale Aspekt und die Gemeinde für die man sich entscheidet, wenn man eine Religion wählt, im Vordergrund. Kein Wunder, denn Molly verbringt mit diesen Menschen in ihrer Kirche unglaublich viel Zeit. Gerne hätte ich gewusst, wie tief ihr Glaube geht und sie bei anderen Dingen beeinflusst. Doch aus irgendeinem Grund hält Molly erst einmal Distanz zu Leuten, die sie noch nicht so gut kennt. Warum — das hätte ich auch gerne noch erfahren.
Die Einstellung zum Beruf, zur Religion oder zum Selbstmarketing sind nur drei Beispiele, die mir die Unterscheide zwischen Amerika und Deutschland Unterschiede aufzeigen. In allen drei Fällen haben sowohl die amerikanische als auch die deutsche Herangehensweise Vor- und Nachteile. Durch den RIAS-Aufenthalt ist es mir zumindest in kurzen Momenten gelungen, die andere Logik wirklich zu verstehen. Ich hatte immer öfter mal die U.S.-Brille auf. Klare Sicht — zumindest für kurze Zeit.
Sarah Zerback, Deutschlandfunk, Köln
#TrumpRegrets
„Donald Trump ist die Kim Kardashian der Politik“ — der Twitter-König, der mehrmals am Tag mit krawalligen Tweets für Aufregung sorgt. Es ist ein Reporter von ABC News, der diesen gewagten Vergleich zwischen Präsident und Reality-TV-Star anstellt, der erzählt, wie es ihm seitdem vor dem morgendlichen Griff zum Smartphone graut — vor allem samstags — und wie der neue Präsident so Redaktionen im ganzen Land auch am Wochenende auf Trab hält. Er wird nicht der letzte Gesprächspartner auf unserer USA-Reise bleiben, der klar macht: Es hat sich etwas grundsätzlich verändert, seit das Land von einem Mann regiert wird, der Twitter zu seiner primären Verlautbarungsplattform gemacht hat. Allerdings ist das auch das Medium, auf dem sich seine Gegner formieren. Und zunehmend auch einstige Unterstützer. Unter dem Hashtag TrumpRegrets machen enttäuschte Wähler ihrem Ärger Luft. Darüber, dass die großen Wahlversprechen entweder bereits gebrochen sind, an der Umsetzung scheitern oder sich sogar explizit gegen jene richten, die ihr Kreuzchen für Trump gemacht haben. Die Gesundheitsreform ist dafür eines der eindrücklichsten Beispiele — das lernen wir beim Treffen mit „Families USA and Healthcare“. Wie lange es wohl dauern wird bis auch dem letzten Trump-Wähler klar wird, dass er sich ins eigene Fleisch geschnitten hat? Eine Prognose wagt niemand, den wir in den drei Wochen treffen. Schließlich hätte auch niemand ernsthaft damit gerechnet, dass Donald Trump der 45. Präsident der Vereinigten Staaten wird — weder die Meinungsforscher von Pew, noch die großen Washingtoner Denkfabriken wie das Center for National Interest oder all die erfahrenen Hauptstadtjournalisten.
#RealitätsCheck
Die sind spätestens seit dem 20. Januar vor allem damit beschäftigt, den „alternativen Fakten“ des neuen Präsidenten mit — nun ja — Fakten zu begegnen. Seit der Erfinder des Begriffs „Fake News“ im Amt ist, erfordert diese ur-journalistische Aufgabe mehr Ressourcen. Und so haben Redaktionen wie das National Public Radio oder die Washington Post Personal aufgestockt und spezielle „reality checking teams“ ins Leben gerufen, die recherchieren, richtigstellen und die Ergebnisse mit speziellen Online-Tools visualisieren. Doch eine Lüge auch eine Lüge zu nennen, davor schrecken die meisten Journalisten, die wir treffen, zurück. Zu viel Wertung. Hörer, Zuschauer, Nutzer sollen sich ihre eigene Meinung bilden. Eine journalistisch absolut saubere Haltung. Und doch auch eine, die überrascht und die hier nicht zum Mainstream gehört. Das zeigt das morgendliche Zappen durch die 137 Kanäle des Hotel-Fernsehers. In Morning Shows reden sich die Moderatoren in Rage — wahlweise sehr pro oder sehr contra Trump. Und so ist es auch ein zappen zwischen Parallelwelten, die ganz und gar unterschiedliche Realitäten abbilden. Bleibt die Frage, ob Politiker, Journalisten, Bürger daraus lernen, ob sie bereit sind, sich auch mit der jeweils anderen Meinung auseinanderzusetzen, um den Trend „Affirmation statt Information“ zu stoppen. Es ist eine Frage, die alle umtreibt, mit denen ich mich unterhalte, in Washington, Boston und New York. Wohl wissend, dass die Ostküste nicht der Rostgürtel der USA ist, sondern quasi das andere Ende des politischen Spektrums beheimatet.
#FeindUndFaszinosum
Und so eint die Journalisten, mit denen wir diskutieren nicht nur die eher liberale Haltung — Fox News steht dieses Mal nicht auf dem Programm — sondern auch die Schwierigkeit über einen Präsidenten zu berichten, der die Presse zum Feind erklärt hat, der einzelne Journalisten oder ganze Medienanstalten lächerlich macht, sie beschimpft oder ihnen den Zugang verwehrt, zum Beispiel auf Staatsreisen ins Ausland. Und doch hat die Beziehung zwischen Presse und Präsident auch etwas Symbiotisches. Selten war mehr zu tun, selten war es spannender zu berichten. Ein Fernseh-Reporter etwa, der nicht namentlich genannt werden möchte, erzählt uns mit leuchtenden Augen von den Monaten in denen er Trump auf seiner Wahlkampftour durchs Land begleitet hat. Von den ersten Tagen, in denen er dachte der Kandidat sei nicht mehr als ein kurzes, aber heftiges Phänomen, bis zu dem Moment wo klar wurde: Er ist gekommen um zu bleiben. Der U.S.-Kollege ist nicht der einzige, der Trumps Rhetorik lobt, der bewundert, wie es ihm gelungen ist, Zehntausende bei Wahlkampfveranstaltungen in Footballstadien zu überzeugen und schließlich 60 Millionen, ihn ins Weiße Haus zu wählen. Die USA waren bereit für Trump — so lautet eine Analyse, die wir oft hören — der wusste die Stimmung nur zu erkennen und für sich zu nutzen.
#KeepAmericaGreat
Das der Polit-Neuling aber wüsste, wie er vom Wahlkampf-Modus zum Regieren übergeht, daran haben erfahrene Polit-Insider doch erhebliche Zweifel. Besonders eindrücklich hat uns das Sally Canfield geschildert, die das Weiße Haus und die Arbeit der Republikaner auch aus der Zeit sehr gut kennt, in der sie für die Bush-Administration gearbeitet hat. So viel Chaos war nie. So wenig Information selten. Und ein Präsident, der sich so wenig auskennt in der Welt der Politik: Auch das hat man in Washington so noch nicht erlebt. Das aufzudecken, dabei erfüllt die Satire in den USA eine wichtige Funktion. Charmant, bissig und vor allem witzig fühlt Trevor Noah jeden Abend in seiner Daily Show Präsident Trump, aber auch allen anderen politischen Playern auf den Zahn. Wir waren einen Abend zu Gast und durften uns den Late-Night-Star in Aktion anschauen — am Ende unserer dreiwöchigen Rias-Reise, in der wir versucht haben, ein wenig besser zu verstehen, wie die Amerikaner ticken und wie sich ihr Land verändert unter Präsident Trump. Gerade mal anderthalb Monate nach dessen Amtsantritt ist es noch zu früh für ein Zwischenfazit. Und es ist definitiv zu früh, um bereits ein Ende der Ära Trump einzuläuten. Auch das haben wir gelernt. Ganz im Gegenteil: Während Donald Trump sich bereits Ende Januar seinen Wahlkampfslogan für das Jahr 2020 hat schützen lassen — Keep America Great — da halten auch viele Experten eine zweite Amtszeit durchaus für möglich. Darauf wetten würde aber natürlich niemand. Das ist schließlich schon einmal schiefgegangen.
Danke Rias, für das spannende Programm, die ausgezeichnete Organisation und die großartige Auswahl der Reisetruppe — Das waren drei Wochen, die ich nie vergessen werde!
USA-Herbstprogramm
9.–27. Oktober 2017
TEILNEHMERBERICHTE
USA-Herbstprogramm
Nural Akbayir, Westdeutscher Rundfunk, Köln
Meine letzte Reise in die USA ist etwa sechs Jahre her. Zeit also, wieder hin zu kommen. In der Hauptstadt war ich sogar noch viel länger nicht mehr gewesen. Und dort beginnt die spannende RIAS-Reise, in Washington, D.C.
Der erste Abend, im Hotel angekommen, lerne ich gleich meine elf Fellows kennen. Es ist schon dunkel, noch warm, ich bin aufgeregt und freue mich auf die neuen Gesichter, die ich an der Hotelbar auf unserer Dachterrasse treffe. Nach kurzen Kennenlern-Gesprächen ist schnell klar, das wird eine gute Reise!
Washington fühlt sich wichtig an, so als würden hier bedeutende politische Entscheidungen getroffen werden. Vielleicht, weil sie das auch einfach werden. Gleich am nächsten Morgen treffen wir auf unsere ersten Gesprächspartner. Auf Journalisten und Lobbyisten, wir besuchen Think Tanks und viele Radio- und Fernsehstationen. Wir sind zu Gast bei dem spanischsprachigen TV-Sender Telemundo, der mich sehr beeindruckt. Hier wird Programm gemacht für die lateinamerikanische Community in den USA. Lori Montenegro von Telemundo erzählt uns von den unterschiedlichen Ansichten und Bedürfnissen der einzelnen Latino-Gruppen. Dass Mexikaner etwas anderes wollen, als Kubaner oder El Salvadorianer, dass streng gläubige und konservative Latinos oft hinter Trump stehen. Dass es sich hier, wie bei vielen anderen kulturellen Gruppierungen auch, um eine sehr heterogene Gruppe handelt, und wie Telemundo Programm für diese Menschen macht.
Schon sind wir bei dem einen Thema, dem einen Menschen, dem ich insgeheim ein wenig entfliehen möchte. Das wird hier allerdings nicht passieren. Donald Trump ist überall.
Das bekannte Pew Research Center und die renommierte Brookings Institution beschäftigen sich ebenfalls mit dem US-Präsidenten und etwa damit, wie er und die USA von anderen Ländern wahrgenommen werden.
Unsere Gesprächspartner erzählen uns sehr persönlich, wie sie den Wahlabend erlebt haben, wie sich das Land seit dem verändert, und ein Satz fällt dabei immer wieder: „Das haben wir nicht kommen sehen.“ Meist gefolgt von einem Moment der Stille. Trump ist in dieser Stadt nicht zu entkommen.
Bei der ARD in Washington begegnen wir Kollegen, die wir sonst nachts aus dem Bett klingeln, um mit ihnen zu schalten. Es fühlt sich fast etwas heimisch an. Ähnlich geht es mir auch bei NPR, dem öffentlichen Radio der USA. NPR setzt auf Information statt auf Kommerz. Für die Radiomacher dort ist die Arbeit seit der fake news-Debatte sehr viel härter geworden. In diesen Zeiten sei es wichtiger denn je, ihrer journalistischen Präzision treu zu bleiben. Dafür sei das politische Interesse der US-Amerikaner seit der Präsidentschaftswahl erheblich gestiegen.
Besonders spannend ist auch der Besuch bei der ältesten Menschenrechtsorganisation des Landes, der ACLU, der American Civil Liberties Union. Christopher Anders erzählt uns, wie sie nur eine Stunde nachdem Trump den Muslim Travel Ban verhängt, im Supreme Court sind. Sie waren die ersten. Und auch bei der ACLU gibt es einen positiven Nebeneffekt: Die Mitgliederzahl hat sich seit der Wahl auf zwei Millionen Mitglieder vervierfacht.
Bei vielen unserer Gespräche, die wir in Washington führen, bin ich überrascht und gleichzeitig beeindruckt von der Offenheit, die uns entgegengebracht wird. Oft verlassen wir die Büros und Konferenzräume nicht nur mit journalistischen Eindrücken, sondern auch mit einer Menge persönlicher und emotionaler Geschichten, die uns sehr bewegen. Und so emotional und voller neuer Eindrücke geht die Woche in Washington zu Ende. Zeit, Abschied von der Gruppe zu nehmen. Wir vermissen uns jetzt schon und wissen, auch nach diesen drei Wochen werden wir uns wiedersehen. Ein bisschen pathetisch darf es hier in den USA ruhig sein. Also, auf nach Indiana!
***
Der mittlere Westen der USA ist neu für mich. Auf der Fahrt vom Flughafen in Indianapolis nach Bloomington, der kleinen, netten, bunten 80.000 Einwohner-Studentenstadt, werde ich von Kornfeld an Kornfeld begrüßt und von riesigen Schildern am Straßenrand: „Jesus is coming. Ready or not“, „Only one way to heaven!“. Na hoffentlich fahre ich in die richtige Richtung.
In Bloomington mache ich Station bei dem öffentlichen Radio- und Fernsehsender WFIU/WTIU, ein NPR-affiliate, der an der Indiana University (IU) stationiert ist. Die fast 200 Jahre alte Universität gehört zur Public Ivy League. Der Campus ist extrem idyllisch, die Menschen sehr offen, freundlich und gebildet. Bloomington ist einfach schön. Und Bloomington ist eine Blase im sonst so konservativen Indiana. Midwest eben, den ich auch noch erleben darf.
Während meiner Station Week begleite ich Kollegen auf Drehs, schaue mir verschiedene Sendungen an, die entstehen, und bin selbst als Reporterin für die Redaktion unterwegs. Radio, Fernsehen, Internet – hier machen viele alles und alles allein. Mir stellen die Kollegen dann aber doch Kameramann Zach zur Seite. Wir fahren zu zwei Terminen in die Hauptstadt Indianapolis. Die Interviews laufen gut, wir sind schnell fertig und wollen grade zurück in Richtung Redaktion, da klingelt Zachs Handy. Der berühmte Anruf aus der Redaktion: „Könnt ihr noch schnell nach xy fahren, da gibt es so ne Story…“
Also wieder ins Auto, nochmal anderthalb Stunden durch das platte Indiana zu einem Brückenfestival, eine Art Jahrmarkt mit fast 200 Ständen und Buden. In einer dieser Buden soll ein Mann „slave shackles“ verkaufen. Handschellen aus der Sklavenzeit, mit der Inschrift „negro woman or child only“. Für 250 Dollar. Zach und ich fragen uns auf der Fahrt, ob das ein Scherz ist und was tatsächlich an der Geschichte dran ist.
Als wir ein offizielles Ortsmitglied sprechen, sagt er uns ganz selbstverständlich in die Kamera, es sei vielleicht etwas geschmacklos, und er könne auch verstehen, dass das einige Menschen treffen könnte, aber wirklich schlimm sei so ein Verkauf ja nun auch nicht. Es ist Teil der amerikanischen Geschichte, man müsse die Sklaven-Handschellen als Antike ansehen, die jemand verkauft. Verboten sei das schließlich nicht, „no big deal“ eben. Zum Abschied schenkt er uns noch eine Tüte selbstgemachte Bonbons.
In der Republikaner-Hochburg Indiana denken viele Menschen wie er. Und so sehr ich den Kopf schütteln möchte, bin ich froh darüber, eine Woche in Indiana verbracht zu haben, auch außerhalb vom schönen bunten Bloomington. Der mittlere Westen ist eben anders als Washington oder New York. Und da geht es als nächstes hin.
***
„Ich freue mich so“ ist wohl der meist geschriebene und gedachte Satz an diesem Tag. Eine Woche waren wir 12 voneinander getrennt und heute Abend sehen wir uns wieder. Wieder an der Rooftop-Bar, wieder im Hotel, aber dieses Mal in New York City. Die Stadt überwältigt mich, wie sie mich immer überwältigt. Wir kommen an, erzählen von unseren Stationen, und freuen uns einfach auf eine weitere amazing und awesome Woche zusammen. Endlich wieder vereint!
Die Woche in der Stadt fliegt nur so dahin. Wir besuchen newsrooms, sprechen mit Journalisten und Programmmachern bei NBS, CBS, CNN. Wir sind zu Gast bei der Daily Show mit Trevor Noah, ein persönliches Highlight. Dazwischen diese impulsive Metropole, Lichter, Leute, Wolkenkratzer. In dieser Woche wird viel gestaunt.
Und wieder viel gesehen und diskutiert.
Bei CNN sprechen wir über die Bedeutung ihres Leitsatzes „facts first“ und was guter, faktenbasierter Journalismus in diesen Zeiten für sie bedeutet. Bei CBS besuchen wir 60 minutes. Einer der Reporter der Sendung, Bill Whitaker, zeigt uns seine preisgekrönte Reportage über deutsche Gefängnisse. Keine Gitterstäbe wie in den USA, sondern Türen. Inhaftierte, die sich während ihres Ausgangs mit ihrer Familie auf ein Eis treffen und einen eigenen Schlüssel zu ihrer Zelle bei sich tragen. „You`ve got the key to your own cell?!“ sagt Bill Whitaker fast ein wenig entsetzt. Das hatte er so nicht erwartet. Kopfschütteln bei den Amerikanern.
Später schauen wir uns in einer privaten katholischen High School für Jungen den Schießstand im Keller der Schule an. Gewehre, Helme, Tarnkleidung – für die minderjährigen Schüler. Das hatten wir so nicht erwartet. Kopfschütteln bei den Deutschen.
In New York erleben wir einen weiteren Programmpunkt, der uns alle sehr beeindruckt. In der Suppenküche der St. James Church kochen wir eine Mahlzeit für Obdachlose und teilen das Essen an sie aus. Wir sind sehr dankbar, Teil dieser Initiative sein zu dürfen, und dass uns auch diese wichtige Seite der USA nochmal so verdeutlicht wird.
Diese drei Wochen sind voll von wunderbaren und prägenden Eindrücken. Ich lerne viel über US-amerikanischen Journalismus und mir wird während dieser Zeit nochmal ganz bewusst, was ich an den USA so schätze. Die Vielseitigkeit des Landes und der Menschen. Dass es hier alles und jeden gibt.
Danke an die RIAS Berlin Kommission für diese großartige Zeit und die vielen wunderbaren Begegnungen und Erfahrungen, dafür, nun Teil der großen RIAS-Familie zu sein, und natürlich danke an die tollste Reisegruppe ever!
Torsten Beermann, Westdeutscher Rundfunk, Köln
Honestly, I thought I knew the United States quite well. But after this trip I must admit, I learned so many things about the country and the people; Thanks to Rias! What I would like to say: This exchange program was a real enlightenment for me. And what a perfect timing: The election of Donald Trump as US-Presiden; now shaking the whole political system, the media and society in the US – and we were just arriving to experience the major changes.
Starting in Washington D.C., we met many very interesting, smart, people with influence and deep insights in politics, society or science. For example, I learned at Pew Research how fundamentally the image of the USA has changed in the eyes of foreign countries. Constanze Stelzenmüller from Brookings talked with us about the new government´s impact with their new foreign policy, influencing for example Europe and Germany. With Ilya Shapiro from the Cato-Institute, we discussed about gun-control and tax reforms.
Or Jeff Mason: We met the former president of the White House Press Association for Dinner, where he spoke about the challenge of a president attacking journalists as part of „fake-news“ and a „lying media“. I could furthermore mention many of our other stops. For example the one at the association of american family physicians. To learn the details of the american health-system and especially the affordable-care-act was strongly helpful for my understanding of US-politics.
And very important to me was my outstanding Group. Led by Erik Kirschbaum and cohosted by Annette Raveneau, we enjoyed a very well organized schedule, which made it possible to have the maximum in the three weeks. The atmosphere amongst us 12 very experienced journalists was amazing: We will definetely stay in touch.
If I had to choose, I would say, the outstanding highlight among so many highlights was my „station week“ in Atlanta at CNN. Five days of insights at one of the leading domestic and international TV companies – that was awesome. I had the chance to be in nearly every important department of CNN, participated in the main editorial meetings and spoke to the leading journalists, producers, researchers and editors of this flagship of news-television. Especially helpful was , to see how the CNN-Newsroom works and how it is organized. A knowledge that will for sure help me at the WDR, where we are planning our huge project – the biggest change in structures for the last decades.
At CNN, I met so many journalists that were extraordinary interested in Germany: How does our media system work? How are we coping with the challenge of reporting for the internet? What does the success of the AfD mean? Some of them were definetely great fellows for the American exchange program.
Our third week in New York City also included some impressing experiences for us. I will never forget the morning at St. James Church on the upper east side, when we prepared and served lunch for a hundred homeless people. I talked to some guys, that told me, that although they were in regular jobs, they still could not afford the rents in NYC. This left a lasting impression on me. I also liked the visit of Xavier High-School, a religious „boys-only“ school in Manhattan – and learning more about the school-system in the US. 18.500 Dollar of annual school fee at Xavier are half of what some of the most prestigious schools in NYC demand from the parents – and though hard to bear for many. Luckily, they may be supported by scholarships and donations from former students.
In the end these are my conclusions: The United States are blessed with a beautiful country; with smart, helpful and cordial people, who show passion for their job, what I truely admire. I am still fascinated by the USA, who made big efforts to free Germany from the Nazi-Regime and ended the Second World War.
But another impression was, that money has to much impact on everything important, like The media, the society, health-care, the school-system – and a lot more. The American dream still exists, but too often only for a small group of well educated, well supported people from the „upper-class“. Many Americans in the big cities nowadays struggle to earn enough for their living. I met black people who are afraid, that their children, might be shot by the police. Unbelievable for me as a German.
After these three weeks, I am more convinced than ever, that Germany should be proud of all its social services and its health system. It is a fact: Sometimes you have to look with the eyes of foreigners to be reminded of how well your own country is running.
In the future, I will come back to the States to work in our bureaus in Washington DC or New York City. Therefore, I think, my unique experiences with Rias are extremely useful. I got insights, that I would otherwise never had. I got to know important people, I otherwise had not met. I got a more detailed impression of the United States, that will improve my reporting about this great country.
I am extraordinary thankful for that; for giving me the chance of participating in this excellent exchange program. Thank you!
Amerika unter Präsident Donald Trump – was hat sich verändert, was entsteht an neuen Ideen und politischen Bewegungen, welche Themen beschäftigen die Menschen außerhalb der Politik. – Das war es, was mich vor allem interessierte. Eine Reise, nicht als Urlauber, sondern als Journalistin, mit der Gelegenheit Menschen zu treffen, die man bei Citytrips sonst eher nicht kennenlernt.
In Washington, der Stadt der großen Politik gab es den einhelligen Tenor: Wir hätten nicht gedacht, dass Trump tatsächlich Präsident wird. Interessant für mich unter den wirklich vielen großartigen Begegnungen waren vor allem der Besuch des lateinamerikanischen Programms Telemundo, bei dem wir viele Hintergründe über das Wahlverhalten und die politische Einstellung dieser Wählergruppe erfahren haben.
Herausragend auch die Besuche beim PEW-Research-Institut, dass sich mit Fragen beschäftigt, wie zum Beispiel „Wie sieht der Rest der Welt auf das Amerika unter Trump?“, sowie beim Cato-Institut, dass mit überraschenden Thesen aufwartete. Zum Beispiel, dass der Klimawandel ja auch seine gutem Seiten hätte. Wenn man zum Beispiel in sonst vegetativ armen Gegenden nun Obst anbauen könne.
In Seattle durfte ich zu Gast sein bei KUOW, einer Public-Radio Station, die ein Regionalfenster für das Rahmenprogramm von NPR erstellt. Seattle, Stadt von Amazon und Facebook hat mit ähnlichen Problemen zu kämpfen, wie unsere Großstädte: explosionsartig steigen Häuserpreise und Mieten an, die Schere zwischen arm und reich wird immer größer, die Verkehrsinfrastruktur ist in den vergangenen Jahren nicht so mitgewachsen wie der Rest der Stadt. Ich hatte viel Gelegenheit zu persönlichen Gesprächen, konnte Beiträge für mein Programm produzieren und durfte Interviews dazu geben, warum in Deutschland Amazon nicht nur positiv gesehen wird.
New York, die Stadt, die niemals schläft, hat dann nochmal ein anderes Tempo vorgegeben. Eindrucksvoll war unser Vormittag in einer Suppenküche einer katholischen Kirche. Essen zubereiten und servieren, mit denen ins Gespräch kommen, die kein Geld haben, um jeden Tag genug zu essen zu kaufen, das bleibt auf jeden Fall lange im Gedächtnis. Als langjähriger NBC-Fan habe ich persönlich mich sehr über den Besuch bei diesem Programm gefreut. Michael Gargiulu hat sich außerordentlich viel Zeit genommen, um uns alle Fragen zu beantworten und das Haus zu zeigen.
Es ist nicht möglich nach einem solchen Programm einzelne Punkte besonders herauszugreifen. Die Tage waren angefüllt mit Gesprächen, besonderen Menschen und Diskussionen. Mein Bild und mein Blick auf die Vereinigten Staaten hat sich nach diesem Besuch verändert. Ich habe Ideen für das Programm mitgebracht, in dem ich arbeite und freue mich auf den Austausch und die künftige Zusammenarbeit mit vielen amerikanischen Kollegen.
Mein Dank gilt den Organisatoren und Begleitern der Reise Annette Ravenau und Erik Kirschbaum. Straffes Programm mit vielen Terminen und zum Teil weiten Wegen, perfekt aufeinander abgestimmt, immer mit Wünschen nach Feedback, immer daran interessiert diese Reisen künftig noch besser zu machen.
Mehr auch in meinem Blog : https://anja-goerz.de/category/blog/
Laura Koppenhöfer, Südwestrundfunk, Baden-Baden
„We always had extreme racists in the US,“ sagt die renommierte Wissenschafts- journalistin Cynthia Barnett. „But they stayed under their slimey rocks. Now with Trump they dare to come out again!“ Sie spricht besonders pointiert aus, was viele umtreibt, rund um den Auftritt des White-Supremacy-Aktivisten Richard Spencer an der University of Florida: Dass Trump rechtsextreme Bewegungen zwar nicht explizit unterstützt, aber durch seine nationalistische Haltung – und auch durch bestimmte Äußerungen – ermutigt und deckt. So wie nach den tödlichen Ausschreitungen in Charlottesville, als Trump die rechte Gewalt so halbherzig verurteilte, dass es wie eine Verteidigung klang.
Es ist Spencers erster Auftritt seitdem und ich halte es für echtes Reporterglück, genau in dieser Ausnahmewoche dank meiner station week im sonst eher unauffälligen Gainesville (nördlich von Orlando) zu sein.
Natürlich hatte die UF den Auftritt zunächst abgelehnt. Doch Spencer drohte wirkungsvoll mit einer Klage. Er weiß, dass gerade eine öffentliche Uni schlechte Chancen hat, ein Redeverbot vor Gericht durchzusetzen: Die Meinungsfreiheit wird in den USA besonders konsequent gewährt. Doch jenseits der juristischen Ebene diskutiert halb Gainesville die Frage: Wo sind die Grenzen der „free spech“? Gerade mit Blick auf unsere neue Bundestagspartei AFD und den europaweiten Aufschwung rechter Parteien finde ich diese Diskussion essentiell. Ich spreche sie bei vielen meiner Begegnungen an und mache eine Campus-Umfrage dazu. Dabei erklären viele das Rederecht Spencers damit, dass er ja nicht offen zu Gewalt aufrufe, sie selbst dennoch anders entschieden hätten – schließlich führe seine Ideologie der Rassentrennung und -hierarchie unweigerlich zu Gewalt.
Die KollegInnen in meiner Gastredaktion stehen mehrheitlich hinter der Erlaubnis. Von ihnen höre ich mehrfach, Journalisten müssten pro Meinungsfreiheit sein, egal für wen.
Für die angehenden Journalisten, die in den Lernredaktionen von WUFT-TV und WUFT-FM den multimedialen Praxisteil ihres Studiums absolvieren, bietet der ganze Trubel natürlich beste Trainingsbedingungen, landesweite Aufmerksamkeit inklusive. Sie debattieren in Sonderkonferenzen, produzieren Content für Sonderprogramme, schulen ihre Belastbarkeit in Sonderschichten. Während der sorgsam durchdachte Ablaufplan meines Fellows Michael komplett gesprengt wird: Vieles findet aus Sicherheitsgründen nicht statt oder verschwindet schlicht im Schatten des Spencer-Auftritts. Doch Michael reagiert flexibel von Tag zu Tag und begleitet mich sehr engagiert durch die Woche. Gemeinsam machen wir mehrere Erkundungstouren rund um den abgeriegelten Veranstaltungsort, verfolgen das rasant wachsende Polizei- und Presseaufgebot.
Am Tag selbst bin ich mit im Team bei der Anti-Spencer-Demo. Trotz offensichtlicher Nervosität („Laura, this is crazy shit!“) zeigen die jungen KollegInnen Ausdauer und Biss.
Hier kann ich gut beobachten, dass schon die Studenten auf den gängigen Stil des amerikanischen News-TV getrimmt sind: Energisch sprechen sie ihre Aufsager, dazwischen schneiden sie vox pops oder schnell gedrehte Bilder, die oft selbst in einminütigen Beiträgen mehrfach verwendet werden.
Ihr Equipment ist top, hier zahlen sich die hohen Studiengebühren aus und ermöglichen journalistische Lernbedingungen wie sie in der öffentlichen deutschen Bildungslandschaft kaum vorstellbar sind.
Doch generell scheint Deutschland trotz der teils exotischen Kulisse (Alligatoren in jedem Parkteich, subtropisches Klima, Südstaaten-Küche) gar nicht so weit weg: Michael macht mich mit dem Fotografie-Dozenten John Freeman bekannt, der jedes Jahr mit Studenten nach Berlin reist, um dort einen Fotoband zu realisieren. Ein anderer Dozent interviewt mich für seinen Podcast – und zwar ganz im Sinne der RIAS-Idee:
Gemeinsam reflektieren und diskutieren wir Unterschiede und Gemeinsamkeiten deutscher und amerikanischer Medien. Und Michael bittet mich, den Studenten per „Talk with Q&A“ einen Überblick über Geschichte, Auftrag und Arbeitsalltag des Öffentlich-Rechtlichen Rundfunks zu geben. Ich bin überrascht, wie groß das Interesse ist und wie verbreitet der Wunsch, selbst einmal in Deutschland zu arbeiten.
Viel Zeit für meine mitgebrachten Themenideen bleibt neben all dem nicht, aber eine Reportage für meinen Heimatsender SWR kann ich doch realisieren: Ich will herausfinden, ob sich durch die übermäßig heftige Hurrikan-Saison der Blick auf Klimawandel und -politik verändert hat. Neben der schon zitierten Wissenschaftsjournalistin Barnett interviewe ich dafür u.a. die republikanische Committee Woman und Waffenverkäuferin Sherrie McKnight (BigDaddyGuns.com). Ein nur zehnminütiges, aber unvergessliches Gespräch, in dem fast alle „hot button issues“ des ersten Trump-Jahres zur Sprache kommen: Die Leugnung des Klimawandels („not buying that!“); die Ablehnung von Muslimen („aren‘t the German rape rates rising?“); das kalkulierte Erzeugen von Angst, zum Beispiel bei der Einwanderungspolitik („we need that wall! Would you leave your front door open to let thieves come in and take all your stuff away?“).
Ich erlebe diese Begegnung ähnlich wie den Besuch beim einflussreichen konservativen „Cato Institute“: Tut weh, muss aber sein. Denn gerade in den liberalen „Bubbles“ von Washington und New York ist es sehr einfach, unter Gleichgesinnten zu bleiben, um sich immer wieder kopfschüttelnd zu bestätigen, welch unglaublicher Präsident die USA gerade regiert. Darum sind die station weeks, die viele RIAS-Teilnehmer in die oft zitierten „flyover states“ führt, so unverzichtbar.
Denn eine der zentralen Fragen, die uns kurz vorm Jahrestag der Trump-Wahl beschäftigt haben, ist ja: Was geht nur in den Köpfen seiner Anhänger vor?
Natürlich ermöglicht uns auch der Austausch mit den deutschen und amerikanischen Kollegen diesbezüglich erhellende Einblicke: Beim spanischsprachigen TV-Sender „Telemundo“ lernen wir, warum trotz unzähliger diskriminierender Äußerungen und der geplanten Mauer zu Mexiko ein Drittel der Latinos Trump gewählt haben (hauptsächlich aus wirtschaftlichen Interessen); beim schon erwähnten „Cato Institute“ hören wir, warum eine Limitierung des Waffenbesitzes so ein Tabu ist („if the americans had to give away their weapons there would be a civil war“); der ARD-Korrespondent und RIAS-Fellow Jan Philipp Burgard schildert uns eindrücklich, wie Trump-Fans für jeden noch so skandalösen Fehltritt eine Entschuldigung einfällt. Ihnen scheint sein konkretes Handeln gar nicht so wichtig, ihre Treue fußt auf einer grundsätzlichen gefühlsbetonten Hingabe.
Der journalistische Umgang mit Trump ist in allen von uns besuchten Redaktionen allgegenwärtig: CNN hat sich mit der Kampagne „Facts first“ den erklärten Kampf gegen Fake News auf die Fahnen geschrieben. Das Maß, mit dem hier das Bloßstellen von Trumps Unwahrheiten ins Zentrum der journalistischen Motivation gerückt ist, hat für mich fast schon argentinische Züge. Dort positionieren sich die Medien traditionell und leidenschaftlich für oder gegen die Regierung.
Für uns RIAS-Teilnehmer, die wir fast alle für den Öffentlich-Rechtlichen arbeiten, ist auch der extreme kommerzielle Wettbewerb zwischen den US-Medien ein Thema. Dazu kommt ja oft noch die finanzielle Abhängigkeit von den im Programm werbenden Firmen. Dieses Spannungsverhältnis scheint sich durch den rasanten Ausbau der digitalen Angebote noch zu verstärken: Etliche US-Podcasts starten immer mit einem Werbeblock, zum Beispiel der „Morning Report“ von MARKETPLACE, deren New Yorker Redaktion wir besuchen. Kann ich unter diesem Druck meinen journalistischen Qualitätsansprüchen treu bleiben? Das Problem betrifft die dauerhaft erfolgreichen Medienhäuser mit den großen Namen aus dem RIAS-Programm wohl noch am wenigsten, doch viele kleinere Redaktionen abseits von East- und Westcoast kämpfen ums Überleben und dabei bleibt der erwähnte Qualitätsanspruch schnell auf der Strecke. Dieses Problem, das ja auch in Deutschland zu beobachten ist, klingt in vielen Kollegengesprächen an. Zum Beispiel versichert uns der Investigativ-Reporter von MSNBC, dass er bei Recherchen noch nie Einschränkungen erfahren habe – fügt aber sofort an, dass das nicht selbstverständlich ist.
Umso stärker ist der Kontrast bei NPR, eine für US-Dimensionen kleine Nische, die es sich dank staatlicher Förderung leisten darf, für ein überschaubares Publikum exklusives Programm anzubieten (was sich auf das Haupthaus in Washington bezieht, nicht auf die angeschlossenen Regionalprogramme). Chefredakteur Domenico Montanaro betont das Privileg, dass NPR gar nicht anstrebt, seine Hörerschaft zu erweitern, man sende bewusst für gut gebildete, politisch interessierte Stadtmenschen. Dementsprechend müsse man sich mit Mini-Marktanteilen begnügen. Auch hier drängen sich Vergleiche zum ÖRR auf, dessen permanenter Prinzipienkonflikt (Auftrag/Anspruch vs. Reichweite/Konkurrenz) durch den Spardruck gerade enorm verschärft wird.
Doch auch oder gerade die Begegnungen jenseits der Redaktionen und Think Tanks sind sehr prägend: Die Mithilfe in der Suppenküche der „St. James Church“ öffnet mir die Augen dafür, dass in Manhattan selbst Berufstätige die kostenlosen Mahlzeiten in Anspruch nehmen, weil die obszön teuren Mieten kein Geld fürs Essen lassen. Ich finde es gut und wichtig, dass RIAS mit solchen Terminen den Blick auch in die Zwischenräume und Hinterzimmer von Glitzer-NY lenkt. Mich sensibilisiert das, noch näher hinzuschauen. Sonst würden mir die vielen traurigen Details vielleicht nicht auffallen, als ich einmal am späteren Abend mit der U-Bahn von Brooklyn nach Manhattan fahre und dann noch einige Blöcke zu Fuß gehe. Da offenbart mir die Glitzerstadt ein paar ihrer verwahrlosten Ecken und verlassenen Bewohner. Ich sehe Kakerlaken aus Gullideckeln wuseln, einen obdachlosen Rollstuhlfahrer beim beschwerlichen Errichten seines Nachtlagers und in der Bahn scharenweise müde Schichtarbeiter auf ihren endlosen Pendelfahrten…
Für diese vielen Blickwinkel, Einsichten und Begegnungen bin ich RIAS dankbar. Es ist eine außergewöhnliche Chance, dieses unglaublich dichte und vielschichtige Programm durchlaufen zu können – zumal mit einer so tollen Gruppe.
RIAS wirkt jeden Tag nach: Wenn ich einen Artikel über konservative US-Richter lese und darin genau die Argumente wieder finde, die wir aus erster Hand vom Anwalt bei CATO gehört haben. Dank dieser Vorkenntnisse kann ich auf Anhieb viel tiefer in die Themen einsteigen. Den gleichen Effekt erlebe ich während des Klimagipfels, hierzu habe ich ja sogar exklusive Interviews für meine Reportage geführt.
Der Nutzen des neuen Netzwerks ist natürlich ebenfalls unbezahlbar. Sowohl zwischen den Fellows als auch den Experten, die wir vor Ort getroffen haben. So hat uns Anna Schiller vom hochkarätigen „Pew Research Center“ Studienergebnisse vorab zur Verfügung gestellt.
Ich hoffe, diese und andere Effekte dieser unvergesslichen Reise werden noch lange anhalten, auch dann noch, wenn sich die Rassisten (hoffentlich bald) wieder unter ihren „slimey rocks“ verkrochen haben.
Anja Kwijas, Radio Bremen, Bremen
„Wo fährst Du hin? In´s Trumpland? Hast Du Dir das gut überlegt?“. Wie oft hatte ich diesen Kommentar vor der Abreise gehört. Und ja, ich gebe zu, ab und an kamen mir mal Bedenken. Als die ersten Informationen über die anderen Journalisten, die in diesem Herbstprogramm dabei sein würden, eintrudelten, wurde ich noch nervöser.
Aber: nach und nach wurde aus der Nervosität eine echte Vorfreude! Und so flog ich leichten Herzens am 9. Oktober 2017 von Bremen in Richtung Westen. Am Flughafen in Washington DC traf ich mich mit den ersten Kolleginnen und Kollegen. Das war der Start zu wirklich unglaublichen drei Wochen!
Washington DC
Der erste Tag ging mit „kennenlernen“ zu Ende. Am Zweiten fand das erste Treffen um 7:40 Uhr statt. Metro-Karte besorgen, Fragen beantworten und los ging´s zu unserem ersten Termin: das Pew Research Center, in dem uns mehrere Mitarbeiter über unterschiedliche Forschungsgebiete Einblicke in die Ergebnisse des Instituts und damit auch in das Leben in Amerika gaben. Vom allgemeinen Ansehen der USA im Ausland (welches mit Donald Trump um ein Vielfaches gesunken ist), über die Medianutzung im Wandel der Zeit (vom TV-Gerät zum Smartphone), bis zur Frage „Mit welchen Problemen und Anfeindungen müssen sich Muslime in den USA auseinandersetzen“ waren dieses nur einige Themen, die dieses Forschungsinstitut bearbeitet: https://www.pewresearch.org.
Danach ging´s per Bus und zu Fuß zu WTOP, einem Serviceradiosender in Washington. Alle 8 Minuten Verkehrsfunk und Wetter, oha!
Einen weiteren Spaziergang später (bei schwülen 29 Grad) waren wir zu Gast bei Brookings Institution, einem Think Tank, in dem sich die Mitarbeiters unter anderem mit der Frage befassen, wie man Amerikanern Deutschland vermittelt. Und umgekehrt. Frau Dr. Constanze Stelzenmüller hat einen unglaublich spannenden Vortrag aus dem Ärmel geschüttelt. Aber auch Molly Reynolds mit ihrer Analyse über die aktuelle Verfassung in der die amerikanische Regierung steckt, hat mich schwer beeindruckt. Viel gelernt, so viel ist klar. https://www.brookings.edu/
Ein zünftiges „get together“ mit Jeff Mason, Präsident der White House Press Association, in einer Bierkneipe hat den Abend abgeschlossen. Whow, und das war erst der erste Tag.
Weiter ging es an einem sonnigen Mittwochmorgen, der auf eine schwülen Tag schließen lies. Washington DC im Oktober – da gerät sowieso jeder Reiseexperte in´s Schwärmen: „Indian Summer, goldene Farben, beste Reisezeit!“. In diesem Jahr war es im Oktober allerdings etwas anders, selbst amerikanische Wetterexperten sprachen vom „insane fall all over the country“ und unnormalen Werten: Temperaturen über 30 Grad und eine drückend hohe Luftfeuchtigkeit liessen jede Föhnfrisur innerhalb von Minuten wie einen zerdrückten Wollehaufen aussehen. Beim Besuch der Gesprächspartner überraschte einen dann die Klimaanlage: Gänsehaut, Jacke rauszerren, Tuch über die nackten Schultern werfen.
Das erste Meeting hatten wir bei NBC Telemundo, einem TV-Programm für die Hispanische Community in den USA. Der Sender gehört zu NBC Universal. Die Studios, bzw. Büros liegen im selben Gebäude wie NBC Washington und damit auch in unmittelbarer Nachbarschaft zu FOX News, die haben nämlich auch ihre Studios in diesem imposanten Gebäude. In der Hallway vor den Fahrstühlen begegnete uns eine Frau, umringt von anderen aufgeregten und aufgetakelten Menschen, und wir dachten alle: „Wer ist das, wer ist das…Ahhh! Alternative-News-Kellyanne Conway! Now we are talking!“.
Bei Telemundo führte uns Lori durch die Räume und durch die Geschichte des Programms. Mit welchen Plänen und Zahlen es startete, wie es gewachsen ist und mit welchen Problemen und Herausforderungen es heute umgehen muss. Nach den Katastrophen der vergangenen Monate ist das eine Menge: die Hurricanes in Florida und Puerto Rico, die Erdbeben in Mexico und Donald Trump. Die Zu- bzw. Abneigung für den neuen Präsidenten ist auch unter Hispanics davon beeiflusst, woher die Menschen kommen, wie sie in die USA eingereist sind, ob sie Papiere haben oder nicht und wie ihr Status allgemein ist. Das ist eine hochspannende Thematik. Das Puerte-Ricaner als Hochburg der Hispanic-Konservativen mehrheitlich Trump gewählt haben, dass die Kubaner in Florida aber gegen ihn gestimmt haben, das alles war mir so nicht bewusst! Ein tolles Erlebnis, dieser Besuch bei NBC Telemundo.
Danach erschienen wir pünktlich im ARD-Studio Washington und wurden von einer unserer Stimmen aus dem Hörfunk begrüßt: Gabi Biesinger. Von London nach Washington DC ist sie seit ein paar Monaten als Korrespondentin und Leiterin der Hörfunkgruppe dort tätig. Nach einem Rundgang durch das Studio stießen die TV-Kollegen Jan-Phillip Burghard (Rias-Fellow)und Stefan Niemann zu uns. Zum Q & A, wie man so schön sagt, also zum Fragen und Antworten. War superspannend, aber leider drängte die Zeit. Denn wir waren noch bei der AAFP erwartet, der American Academy of Family Physicians. Grob übersetzt der Interessensgemeinschft der amerikanischen Hausärzte. Dort gab es jeeeede Menge Erkenntnisse, Zahlen und Informationen über die unendliche Diskussion zum Thema Obamacare. Statusmeldung: es ist und bleibt wohl noch länger kompliziert! Andrew Adair hat wirklich alles gegeben, um uns einigermaßen auf den Stand zu bringen, aber das amerikanische Gesundheitssystem ist echt eine Sache für sich!
Am nächsten Tag führte uns unser erster Termin zur ACLU. Hinter dieser Abkürzung verbirgt sich die American Civil Liberties Union, eine der bekanntesten Bürgerrechtsorganisationen in den USA. Wir treffen Christopher Anders, leitender Anwalt, der uns über die ACLU und seine Arbeit viel erzählen kann. Sehr viel. Wir diskutierten über Guantanamo und warum Barrack Obama es nicht geschafft hat, dieses Militär- und Hochsicherheitsgefängnis während seiner Amtszeit zu schließen. Obwohl er es mit viel Pathos als eines seiner dringlichsten Ziele angesehen hatte…..superinteressant!
Nach einem Mittagessen geht es per Bus zur Deutschen Botschaft. Wir trafen den aktuellen Botschafter Peter Wittig. Das Thema „Trump und Deutschland“ war natürlich sofort auf der Agenda. Nach einer knappen Stunde Gespräch machten wir ein gemeinsames Foto und das war es.
Mit Bus und U-Bahn und zu Fuß ging es dann zurück. Ganz schön lang waren wir unterwegs, aber die Aussicht auf einen Rias-Fellow-Abend im Biergarten ließ uns das tapfer durchziehen. Ja, DC hat einen Biergarten. Also, einen Outdoorbereich mit jeder Menge Biergarnituren, Sonnenschirmen, etc., den „Wundergarten“. Geführt von einem Deutschen, einem Münchner, dementsprechend gab es bayerisches Bier, den Versuch einer Bratwurst und natürlich Burger. Es waren auch andere Journalisten aus DC dabei, leider weniger, als wir gehofft hatten. Denn Netzwerken und Kontakte knüpfen ist ja auch etwas, wofür dieser Austausch mit der Rias Kommission gedacht ist. Toll war der Abend aber trotzdem!
Am Freitag, dem 13., hatten wir unseren ersten Termin beim NPR Washington, dem Headquarter vom National Public Radio. Dieser Sender ist am ehesten mit den Öffentlich-Rechtlichen in Deutschland zu vergleichen. NPR bekommt ein wenig Geld vom Staat, hauptsächlich finanziert er sich aber über Sponsorship und Spenden. In Washington DC wird das „Mantelprogramm“ für alle Regionalsender des NPR produziert. Eigene Sendestrecken kommen natürlich aus den jeweiligen Regionen von eigenen Reportern noch dazu. Wir sprachen mit zwei Journalisten, der eine betreut die Politikredaktion „Inland“, dazu noch Online und Podcasts, der andere ist Senior Editor für Europa. Drei mal darf man raten worüber wir gesprochen haben……. Jawohl: Trump, die nächste Klappe!
Superspannend, was sich für die Kollegen verändert hat. Wie unterschiedlich diese Veränderungen aber auch eingeordnet werden. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass das NPR von den Hörern sehr treu begleitet wird und sie sich gut informiert fühlen. Die meist gut gebildete Zuhörerschaft hat zwar auch mindestens ein Drittel Republikaner unter sich, diese sind aber mit der aktuellen Regierung überhaupt nicht zufrieden. Sie interessieren sich auch mehr als andere Parteianhänger der GOP, der Grand Old Party der Republikaner, mehr für Dinge, die im Ausland passieren, also zum Beispiel in Deutschland. So hat sich der NPR auch sehr der Bundestagswahl in Deutschland gewidmet. Das ist für amerikanische Medien überhaupt nicht selbstverständlich.
Nach den Gesprächen bekamen wir eine Führung durch den Newsroom, den wir nicht fotografieren durften, und die Studios. Einen letzten Abstecher machten wir dann zu NPR Music, einer Redaktion, die ich von Deutschland aus mit großem Interesse über Facebook verfolge. Das Programm von NPR Music fasst bereits etablierte, aber auch total unbekannte Musik zusammen. Wobei fast alle Genres vertreten sind. Absolutes Highlight für mich ist NPR „Tiny Desk“! In dieser Sendung spielen Musiker in einer kleinen Schreibtischecke akustisch, bzw. nur minimalst verstärkt. Und der Sound ist immer großartig! Der Techniker vom NPR Tiny Desk hat meine Lobeshymnen darauf gerne angenommen. Und ich habe mich gefreut wie ein Kind, am Desk ein Foto machen zu dürfen.
Und damit war der offizielle Teil der ersten Rias-Woche bereits beendet, unfassbar wie die Zeit verging.
Charlottesville, Virginia
„Krass! 127 neue Nachrichten! Ihr habt mir schon gefehlt……“ Mit dieser Message von Ralf lässt sich der Sonntag gut zusammenfassen. Die Fellows sind über die USA verteilt und trotzdem haben alle das Bedürfnis, sich mitzuteilen. Ob nun diejenigen, die happy an ihren jeweiligen Zielorten angekommen sind, oder diejenigen, die stundenlang an Airports warten mussten: alle schickten Bilder und erste Eindrücke. Krass!
Ich bin mit dem Amtrak nach Charlottesville, kurz: Cville, gefahren. Von Washington DC durch die Landschaft Virginias. Unablässig begleitet vom Heulen der Zugsirenen. Vorbei an einsamen Bahnübergangen und Farmen, aber auch durch kleine und mittelgroße Örtchen. Und wenn ich schreibe „durch“, dann meine ich „durch“…. Mit knapp 5 bis 10km/h, durch enge Kurven und Windungen. Stark! Ich meine, den Blues jetzt besser zu verstehen. Immer diese riesigene silberfarbenen Züge sehen, aber selbst in der klitzekleinen Heimat feststecken? Da muss man doch frustriert drüber singen!
Cville steht noch unter den Eindrücken der Riots im August. Am 11. und 12. August versammelten sich hier Mitglieder der verschiedenen Rechten Gruppierungen Amerikas. Unter dem Motto „Unite the Right“ kam es zu schweren Ausschreitungen und Kämpfen. Am Ende waren drei Todesopfer zu beklagen.
Die einen in Cville wollen drüber reden, die anderen lieber nicht. Mein Host, Sandy Hausman, NPR, wirkt hin und her gerissen, wenn sie diese Frage beantworten soll. Sie ist Radioreporterin und hat das Ganze natürlich für´s Programm aufbereitet. Sie wird mir in der kommenden Woche Menschen aus ihrem Umfeld vorstellen, die dazu ganz viel zu sagen haben.
Sandy, die als Rias-Fellow im Jahr 2011 in Deutschland war, ist die Einzige, die hier das Radio-Büro bespielt, sie ist Reporterin für WVTV & Radio IQ Charlottesville, die beide zum Public Radio-Netzwerk des NPR gehören. Sandy berichtet immer dann, wenn es spannende Themen in Cville gibt. Normalerweise ist hier nicht so viel los, aber nach den Ausschreitungen am 11. und 12. August hat sich das geändert. So wie sich überhaupt die Stimmung in Charlottesville verändert hat.
Dieser Eindruck wurde bestätigt, als ich mit Sandy zum Meeting des City Councils ging. Bei dieser öffentlichen Versammlung des Stadtrates gibt es so genannte Hearings, wo jede Bürgerin und jeder Bürger sprechen kann. Und spätestens jetzt wurde mir klar: die Menschen in Cville sind zum Teil absolut traumatisiert. Gerade die Bürgerinnen und Bürger aus der Black Community machten immer wieder deutlich, wie sehr sie sich bedroht fühlen. Dass sie einige Teile der Stadt ganz klar meiden, weil sie sich nicht sicher fühlen. Und wie sehr sie es nicht verstehen können, dass nach wie vor Rassisten mit Fackeln und Hakenkreuzfahen durch die Stadt ziehen können. Mit Genehmigung des First Amendements (Freedom of Speech), aber auch mit Geleitschutz der Polizei. Gerade vor einer knappen Woche war das wohl wieder der Fall, als Mitglieder des Ku-Klux-Klans zum wiederholten Mal in den Emancipation-Park zogen und dafür demonstrierten, dass die Monumente des amerikanischen Bürgerkrieges NICHT abgebaut werden.
Die Emotionen im City Council schlugen hoch, vor allem sind alle sauer, dass sich nichts verändert und immer noch darüber diskutiert wird, wie man verhindern kann, dass die Neo-Nazis, Rassisten und Klan-Mitglieder mit Waffen in die Stadt kommen. Kurz angesprochen wurde eine Idee, wie wir sie in Bremen schon eingerichtet haben: Waffenfrei Zonen in der Innenstadt. Damit ist der White Supremacist bestimmt total einverstanden…………. Ich war jedenfalls beeindruckt und dankbar, dass ich diesen Blick hinter die Glitzerkulisse einer superaufgeräumten Downtownmall und Innenstadt von Cville bekommen habe. Ich habe jetzt verstanden, dass „Cville means love“, dieser Slogan, den sich die Stadt nach den Ausschreitungen selbst gab, ein schöner, abmitionierter Gedanke ist, der aber noch mit ganz viel Leben gefüllt sein will!
In einem Gespräch an der University of Virginia hat Gabriel Finder, der Leiter der Jewish Studies, versucht, mir zu erklären, warum sich bei den Ausschreitungen der Hass gegen Juden so viel Luft gemacht hat. Wo dieser her kommt und wie er die Zukunft sieht. Ein tolles Interview, sehr spanend. Gabriels Eltern kommen aus Stuttgart, bzw. Wien, und beide sind vor dem Holocaust nach Amerika geflohen. Wir haben uns auch über die Situation in Deutschland unterhalten. Der Einzug der AfD in den Bundestag lässt ihn sehr, sehr hellhörig werden. „Wir müssen alle unseren Beitrag dazu leisten, dass sich was ändert. Wir dürfen auf gar keinen Fall sagen: Ach, das überrascht mich nicht!…..Es muss uns immer wieder überraschen, damit wir unsere Hintern hochkriegen und etwas tun!“ Spannender Gedanke!
Spannend war auch mein Ausflug nach Richmond – der Hauptstadt von Virginia. Eine der wichtigsten Städte während des amerikanischen Bürgerkrieges. Und das wird dem Besucher an vielen Stellen verdeutlicht. Die Brücke über den James River, die von den Truppen der Südstaaten gesprengt wurde, damit die Nordstaatler nicht rüber können, wurde auf den alten Pfeilern wieder aufgebaut. Auf der Monument Avenue werden alle herausragenden Männer, die für die Südstaaten gekämpft haben, gewürdigt. Mit riiieesigen Statuen. Kann man mögen……. Die große Black Community in Richmond mag das nicht! Kein Wunder, sind doch einige der historischen Plätze oder Museen direkt in ihren Vierteln. So wird ihnen jeden Tag vor Augen geführt, dass man die Zeit der Sklaverei hier immer noch heroisiert.
Auch in Charlottesville sind die Tage unglaublich schnell vergangen. Einer der letzten Termine führte mich noch einmal zur University of Virginia. Ich hatte eine Einladung zu einem Symposium in der Law School. Es ging um „Bubbles and Biases in Journalism“. War interessant, zumal das Panel gut besetzt war: Kollegen der Washington Post, von Bloomberg und der Huffington Post, sowie der örtlichen Tageszeitung Daily Chronicles waren da, um mit Studenten und uns anderen zu diskutieren. Ein paar Essentials, die bei mir haften blieben, kamen in erster Linie vom langjährigen Journalisten der Washington Post, Richard Leaby: „They will call us fake news, whether we do fake news or not. So we always have to be fair, balanced and present facts. In these dangerous times we better not screw up!“. „Reporting should be apolitical and neutral.“ „Don´t let reporting be overwhelmed by the need for speed!“. Erfahrungen und Weisheiten, die man ohne weiteres auch auf Deutschland übertragen kann.
Bye, bye, Charlottesville. Eine tolle Woche war das! Ein großes „Dankeschön“ auch an Sandy Hausman, die ein sehr sehr netter Host war und ein ganz toller Mensch ist! See you again!
New York City
NBC im Rockefeller Center, CBS mit Bill Whittaker und Marc Lieberman von „60 Minutes“, CNN mit Moderatoren-Legende Richard Quest: in Sachen TV-Network-Sender-Führungen bin ich aus dem Staunen nicht mehr herausgekommen. Ein Newsroom beeindruckender als der andere, überall ein hoher Stresslevel, was den Kampf mit der Konkurrenz angeht, überall der Druck, mit einer vermeintlichen „Breaking News“ als Erster rauszugehen. Wahnsinn!
Was für ein Kontrastprogramm stellt da unser Vormittag und Mittag in der Suppenküche der St. James Parish dar. Denn New York – das bedeutet nur auf den ersten Blick Glitzer, Glamour und Vergnügen. Auf den zweiten stellt man fest, dass die Menschen hier zum Teil knallhart „um´s Überleben“ kämpfen müssen. Für ein gutes Einkommen und den Erfolg nehmen die meisten einen unglaublichen Stress auf sich, der sich dann vielleicht mit einer einigermaßen bezahlbaren Wohnung ausgleichen lässt.
Viele Menschen fallen aber komplett durch´s Netz und können oft nicht wieder aufstehen. New York City hat fast 62.000 Obdachlose. Über die Stadt sind diverse Shelter-Unterkünfte zu finden, in denen sie schlafen und duschen können, aber oft müssen sie diese tagsüber wieder verlassen. Essen gibt es dort nur selten, deswegen sind sie darauf angewiesen, dass sie jemanden finden, der ihnen etwas gibt. Die Kirchen in NYC sind darin sehr aktiv und unterhalten viele Suppenküchen, die über die fünf Stadtteile verteilt sind. In einem der reichsten Viertel New York City ist da zum Beispiel die St. James Parish, eine anglikanische, aber sehr progressive Kirchengemeinde an der Madison Avenue.
Dort waren wir mit angepackt: Wir haben gekocht, geschnibbelt und vor allem serviert, denn die knapp 100 Obdachlosen, die immer Dienstags zum Mittagessen eingeladen sind, werden wie Gäste in einem Restaurant behandelt. An runden Tischen sitzen sie zusammen und werden sehr respektvoll bedient. Und genau das war unsere Aufgabe. Wir haben die Speisen aufgetragen, Kaffee ausgeschenkt, Wasser nachgereicht, Tupperdosen aufgefüllt und so weiter. Darüber hinaus kamen wir mit einigen Menschen in´s Gespräch. Die Geschichten dieser Gäste gingen uns sehr ans Herz. Ans Herz ging mir aber noch viel mehr, wie sehr sich einige über unseren freiwilligen Einsatz gefreut haben, obwohl sie sich zum Teil auch ob ihrer persönlichen Situation uns gegenüber geschämt haben. Ich hatte mehrmals einen dicken Kloß im Hals. Vor allem, als die Suppenküche langsam die Türen schloss und ich wusste, dass auf diese Frauen und Männer niemand wartet, sie gerade den Höhepunkt ihres Tages hinter sich hatten und vielleicht noch nicht einmal wissen, ob und wo sie einen Schlafplatz finden. Das war mit Abstand einer der beeindruckendsten Termine der ganzen Reise!
Aber auch die anderen Termine haben einen nachhaltigen Eindruck hinterlassen: Der Besuch bei der American Jewish Commitee, die Dailyshow mit Trevor Noah, aber auch der Termin beim Pressesprecher des Deutschen Botschafters der Vereinten Nationen. Vielen Dank für all die Hintergrundinformationen zu den aktuellen Problemen der UN. Ganz großartig!
Und damit habe ich mein Fazit für diese drei Wochen USA vorweggenommen: Großartig, absolut! Danke, danke, danke! An Erik Kirschbaum und die Rias Kommission, aber auch an Annette Raveneau, die uns ein Superprogramm in DC und NYC zusammengestellt hat. Ein Riesendankeschön geht dann noch an die anderen Kolleginnen und Kollegen, mit denen ich zusammen eine Gruppe bilden durfte: Ihr seid tolle Journalisten, aber noch tollere Menschen! Wir bleiben in Kontakt!
Anorte Linsmayer, Mitteldeutscher Rundfunk, Leipzig
#WhatsAppNervt
Kenn ich nicht, kenn ich nicht, kenn ich nicht…’, denke ich, während ich durch die Teilnehmerliste meines RIAS-Programms blättere. 11 Rundfunkjournalisten und ich. Drei Wochen in den USA. Washington D.C. und New York City erleben wir zusammen, für eine Woche trennen sich unsere Wege, jeder macht eine „Station Week“ in einem anderen Teil des Landes bei einem anderen Sender. ‚Puh, könnte auch ganz schön anstrengend werden, die ganze Zeit mit der Gruppe zusammen’, meine Gedanken, als gerade wieder das Handy piept und jemand der anderen Fellows eine Frage in unsere WhatsApp-Gruppe schreibt, deren Existenz ich gerade für sowas von unnötig halte. Noch drei Wochen und die Gruppe piept schon jetzt aller paar Tage. Na gute Nacht, das kann ja was werden…
#WelcomeToWashingtonDC
Washington D.C. Erster Abend. Dachterrasse im Hotel, sommerliche Temperaturen und die WhatsApp-Gruppe in Fleisch und Blut hier zusammen am Tisch. Willkommensdrink. Die nächsten Tage in der Hauptstadt sind dann alle ähnlich und doch unterschiedlich zugleich: Mit einem Coffee-to-go und Bagel auf der Hand, eilen wir hinter unserem Organisator Erik her, fürs Trödeln keine Zeit, das Programm ist voll. Die Stopps und Termine bringen mir unterschiedliche Erkenntnisse: Beim „Pew Research Center“ bekomme ich die Fakten für meine Vermutung: 90 Prozent aller Amerikaner bezeichnen sich als religiös. Wie das mit der Wahl eines Präsidenten Trump zusammen passt, auf diese Frage hat niemand eine Antwort. Und das Thema Trump generell, zieht sich durch alle Stopps und Talks, die wir in den nächsten Tagen haben. Beim Lokalradio „WTOP News Radio“ liegt der Fokus auf Stau und Wetter. Faszinierend, dass die Hörer gerade dafür einschalten, wo genau diese Information schneller via Smartphone zu bekommen sind. Bei „The Brookings Institution“ heißt es ‚Trump is always agreeing to the last person he talked to. Eine ziemlich passende Zusammenfassung. Bei „Telemundo“ ein Sender für die 53 Millionen Latinos in den USA, bekommen wir einen recht emotionalen Appell an unseren eigenen Berufsstand: „News is not a moneymaker. As journalists we have a role and purpose in society, we have an obligation.“ Das von einer Kuba-stämmigen Amerikanerin zu hören, rüttelt mich wach. Bei allem, was auch in unserem Mediensystem vielleicht falsch läuft, aber ja, genau darum bin ich Journalistin geworden. Schön, dass es Herzblutjournalisten überall auf der Welt gibt. Ein Besuch im ARD-Studio in Washington zeigt, wie die Hörfunk- und Fernsehkorrespondenten hier arbeiten. Ein Vortrag zum ACA interessiert mich als Wirtschaftsjournalistin besonders: „Obamacare“, der Affordable Care Act – Neu für mich: Jedes Jahr müssen sich die Amerikaner erneut um ihre Krankenversicherung kümmern: Wer hat das beste Angebot, die beste Leistung, den besten Deal? Ein spannendes Thema, von dem wir in Deutschland zwar immer wieder was hören, so ganz verstanden habe ich es erst jetzt. Für mich ganz neu: Der Besuch bei NPR – National Public Radio. Eine Nachrichtenagentur als Hörfunk. Tolles Konzept. Wäre auch für Deutschland praktikabel, gerade weil die vielen Lokalsender finanziell aufs Geld schauen müssen. Wie wäre das, wenn die Inhalte für alle übernehmbar sind. Im Prinzip ein ARD-Sammel aber mit noch mehr Content. Bei der ältesten Menschenrechtsorganisation in den USA, der American Civil Liberties Union, erfahre ich, dass unter der Obama-Regierung mehr Menschen abgeschoben wurden als unter jedem anderen Präsidenten zuvor. Das klingt gar nicht nach dem liberalen und menschenliebenden Bild von Obama, das sich nach Deutschland vermittelt hat. Definitiv ein Aspekt, den ich mir nochmal in einer weiteren Recherche anschauen will. Zum Schluss unserer Hauptstadtwoche dann noch ein kontroverses Gespräch zu den US-Waffengesetzen. In der liberalen Denkfabrik „Cato Institute“ heißt es: „If you would try taking away guns from people, you’d have Civil War.” –
#UndSonstNochSo
Die Preise für Mieten haben mich geschockt. Über 3500 US-Dollar Miete für ein 2-Bed- und Bathroom in DC. Und das scheint für die Verhältnisse dort noch nicht mal teuer. Über New York City will ich gar nicht reden. Ich schlucke. Hoffentlich ist das kein Vorbild für die Entwicklung der Miet- und Immobilienpreise in Deutschland. Auch das Konzept der „Property Tax“ ist spannend und erschreckend. Die Grundsteuer steigt mit steigendem Wert des Grundstücks. Das ist in einigen Metropolregionen der USA so hoch gegangen, dass Hauseigentümer die Steuern nicht mehr zahlen können für Grundstück und Immobilie, die sie teils vor Jahren erworben und bereits abgezahlt haben. Sie müssen verkaufen. Unfassbar. Das schockt mich. Und wie so oft in den USA liegen Schock und Faszination dicht beieinander: Ich probiere über 10 verschiedene MundM-Sorten aus, die es in Deutschland nicht gibt. Ein Traum. An Häusern bemerke ich immer große Vorhängeschlösser mit Codeverschluss. Darin seien die Haustürschlüssel für Makler oder die Putzfrau, heißt es. Praktisch, denke ich – aber ob das sicher ist? Und endlich darf ich auch mal „ubern“. In Deutschland haben wir dazu zwar viel berichtet, aber nur über den Gegenwind und die Gründe und Klagen, warum es das in Deutschland nicht gibt. Endlich kann ich es ausprobieren. Ein Mal drin, stelle ich mit Blick auf die vorbeifahrenden Autos fest: Alle „ubern“. Alleine oder im Carpool. Die App plant den Fahrern die Fahrgäste mit ihren Zielen entsprechend ein. Die Bezahlung geht über die App. Und unterwegs steigen andere Leute zu und aus. Wie ein Bus, nur in kleinster Besetzung. Ich bin begeistert, hoffe auf nette Gespräche mit Mitfahrern, aber irgendwie hängt jeder nur an seinem Telefondisplay, kein Wortwechsel. Auch das: Die Amis und ihre Smartphones. Fast wie zusammen getackert sieht es aus, ohne Social Media scheint nichts zu laufen, alles und zwar wirklich alles wird der Welt mitgeteilt. Meine Aufmerksamkeitsspanne ist dafür gar nicht groß genug, ich sehne mich nach digitalem Detox. Für immer. Da piept plötzlich wieder unsere WhatsApp-Gruppe: Alle sind gut in ihren Station-Week-Zielen angekommen. Auch ich schicke Fotos, mehrfach täglich. Hm, digitaler Detox sieht anders aus, aber hier in den USA ist daran sowieso nicht zu denken.
#ToledosNewsleader
In Toledo, Ohio wohnen ca. 300.00 Menschen. Wie viele lokale Fernsehsender würde es wohl in einer vergleichbaren deutschen Stadt geben? Einen. Wenn überhaupt. Hier: Vier! Vier lokale Fernsehsender, die teils neun Stunden Nachrichten am Tag senden. Wow. Hauptfokus auch hier: Wetter und Stau. Ich verstehe noch immer nicht, wieso die Zuschauer genau dafür anschalten statt auf ihre Smartphones zu schauen, aber offensichtlich tun sie es. Die Fernsehsender sind alle rein werbefinanziert. Und das nicht zu knapp. Während der Sendung gibt es mehrere lokale Werbeblöcke. Ich werde hier zum noch glühenderen Anhänger des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. Vielleicht sind es aber einfach andere Länder, andere Sehgewohnheiten. Trotzdem bin ich froh, dass wir ganze Sendungen und vor allem Nachrichten ohne Werbepausen sehen können. Beeindruckend finde ich die Professionalität des Set-Designs und der Moderatoren. Obwohl es „nur“ Lokalfernsehen ist, moderieren sie wie auf nationalem Level. Ich bin zu Gast bei einem der vier Lokalsender, bei WTOL, der allerdings für zwei der Kanäle Nachrichten produziert. Nur die Moderatoren sind andere, aber das Team und das Studio bleiben gleich. Ich lerne, was eine „B-Roll“ ist, den Unterschied zwischen „VO“ und „VOS“ und was ein „package“ bedeutet. Die Fernsehjournalisten hier arbeiten alle als VJ: Sie fahren zu verschiedenen Terminen und Geschehnissen, filmen und interviewen vor Ort und schneiden aus ihrem Material dann selber ein Stück. Die Inhalte sind wirklich sehr lokal, teils mit vielen Live-Schalten direkt an die Orte des Geschehens – auch wenn es „nur“ die Einweihung eines neuen Gebäudetracks eines Krankenhauses ist. Während dieser Woche habe ich die Reporter begleitet zu ihren Drehs und den Live-Schalten. Spannend für mich war die Professionalität im Studio, genau wie die Finanzierung der Sender, die teils mehrere hundert Mitarbeiter haben. Alles in allem hat die „Station Week“ genau das erfüllt, was sie sollte: Einen Einblick in amerikanischen Fernsehjournalismus geben.
#TheApple
Nach einer Woche dann endlich Wiedersehen mit den Anderen. In New York City. Dem Apfel, der Stadt, die niemals schläft, der weltweit bekannten Filmkulisse, in der fast neun Millionen Menschen leben. Mein drittes Mal in NYC und jedes Mal wieder bin ich geflasht und finde es atemberaubend, diesen Trubel, diese Massen, diese Architektur, diese Gegensätze. Unsere Termine sind fast alle in Midtown-Manhatten, so dass wir viel laufen und das gerne. Soch richtig wie die New Yorker früh zur Arbeit eilen, eilen wir mit: Von NBC zu CBS zu CNN zu Marketplace zur NYU und überall geht es um Trump und den Umgang und die Berichterstattung um ihn. Etwas müde werde ich davon schon, denn viele spannende Themen, wie zum Beispiel die Verschiebung der Mediennutzung auf Social Media, bleibt dabei auf der Strecke. Die Gegensätze in NYC zeigen sich auch bei unserem Besuch in der St. James Church, wo wir für Obdachlose mitkochen und am nächsten Tag eine der privaten High Schools in Manhattan besuchen, die fast 20.000 US Dollar Schulgebühr im Jahr kostet. New York City ist faszinierend und gegensätzlich – nach einer Woche bin ich ausgepowert, die Stadt nimmt einem den Atem. Und dann war es auch Time to say Goodbye… Ein letztes Bagel-Frühstück mit unserer Gruppe und dann Time to Say Goodbye.
#RIASChangedMyLife
So ganz würde ich das nun nicht unterschreiben, aber die Wochen des RIAS-Programmes waren eine wirklich tolle Erfahrung. Ganz besonders aber durch unsere Gruppe und den Austausch und das Zusammensein der anderen Fellows, denn:
#OhneWhatsAppGruppeGehtNixMehr
Das hätte ich wirklich nie gedacht, aber die anderen elf Fellows sind mir sehr ans Herz gewachsen. Vorher ein Gegner der WhatssApp-Gruppe, spamme ich mittlerweile am meisten Zeug hinein und freue mich immer sehr, von den anderen zu hören. Vielen Dank an Euch 11, Vanessa, Charlotte, Anja, Anja, Neus, Laura, Nural, Christian, Ralph, Torsten und Benedikt, die ihr diese Reise so großartig für mich gemacht habt! Ohne Euch wäre es nur halb so gut gewesen. Danke auch der RIAS-Kommission dafür, dass in jedem Jahr noch immer deutsche Journalisten diese tolle Möglichkeit bekommen, so ihren Horizont zu erweitern und an alle Mitarbeiter und Organisatoren für ihre Arbeit, um uns drei unvergessliche Wochen zu bereiten.
Vanessa Lünenschloß, Bayerischer Rundfunk, München
Mitten auf der Straße in der Kleinstadt Greer in South Carolina bleibt Rick Danner stehen und lauscht. Er signalisiert meinem Host Tommy Colones und mir, das Gleiche zu tun. Danner ist der Bürgermeister von Greer und Republikaner. In der Ferne hören wir das Horn eines Güterzugs. „That is the sound of economy“, sagt Rick Danner. Kurz darauf biegt der Zug um eine Kurve und rattert an uns vorbei. Er transportiert Autos. Autos, die das deutsche Unternehmen BMW in South Carolina baut und dann in die Welt exportiert. Internationaler Handel par excellence – und das in einem tiefrepublikanischen Bundesstaat.
Was für uns in Deutschland seit dem Amtsantritt von Donald Trump fast ein Widerspruch ist, ist in South Carolina seit Jahrzehnten ein Jobmotor. 1.200 ausländische Firmen haben dort einen Sitz. Während meiner Station Week in Spartanburg treffe ich immer wieder Menschen wie Rick Danner, die wahnsinnig stolz sind, auf die vielen deutschen, kanadischen, chinesischen Unternehmen in der Region. Und – die sich auch gegen den US-Präsidenten stellen, um die guten Beziehungen ins Ausland zu schützen. Aber dazu später mehr.
Die Station Week ist die mittlere der drei Wochen des Journalistenprogramms der RIAS Berlin Kommission. Begonnen hat alles Anfang Oktober in Washington. Bevor wir in vier Tage voller Hintergrundgespräche und – unvermeidlich – Trump-Diskussionen starten, treffen sich alle 12 Fellows, RIAS Verwaltungsdirektor Erik Kirschbaum und US-Koordinatorin Annette Ravenau zum ersten Kennenlernen an der Hotelbar. Vielleicht ist da wirklich ein besonderes RIAS-Feeling, denn unsere Gruppe von ARD-, ZDF- und dpa-Journalisten wird sofort zu einer Gemeinschaft.
In der US-Hauptstadt dreht sich natürlich alles um Politik und das heißt in diesen Tagen: die Gesundheitsreform – und Donald Trump, das Waffenrecht – und Donald Trump, das Iran-Abkommen – und Donald Trump, die Hurrikan-Folgen in Puerto Rico und Florida – und Donald Trump, und immer so weiter. Man kommt einfach nicht an ihm vorbei.
Etwas wird bei unseren vielen Gesprächen mit Wissenschaftlern, Lobbyisten und Journalisten sehr klar: Die Wahl ist auch ein Jahr danach nur leidlich verdaut. Aus der renommierten Brookings Institution haben vergangene Regierungen regelmäßig Personal rekrutiert – diese tat es nicht. Nun beobachten die Experten aus der Ferne das Wirken des Trump-Stabs. Das Pew Research Center hat analysiert, wie sich das Vertrauen in die Vereinigten Staaten seit dem Amtsantritt von Donald Trump verändert hat. Es schwindet besonders stark in Europa, Asien, Kanada und Südamerika. Bessere Werte als Obama erreicht Trump nur in Israel und Russland.
Viele Medien sind gezwungen, andere Wege zu gehen. Domenico Montanaro und Kevin Beesley vom öffentlich-rechtlichen Radio NPR berichten uns, dass viele alte Kontakte zur politischen Elite Washingtons nun gekappt sind. Sie mussten ein neues Netzwerk aufbauen. Sie prüfen Fakten noch genauer, suchen nach noch mehr unterschiedliche Quellen für ihre Berichterstattung als bei vorherigen Regierungen. Das alles in einer Zeit, in der die News-Schlagzahl durch Trumps Twitter-Eifer stark zugenommen hat. Immer wieder hören wir, dass dahinter Taktik stecken soll: Die Medien werden mit Nichtigkeiten über Twitter beschäftigt, um den Fokus von Themen, wie den Russland-Ermittlungen abzulenken.
Donald Trump. Nach der ersten Woche nehme ich ihn quasi mit, im Gepäck nach South Carolina. Ich will eine Radioreportage machen über diesen republikanischen Bundesstaat, der den Freihandel feiert, obwohl der US-Präsident Protektionismus predigt. Schon einige Wochen zuvor hatte ich mit meinem Host, Tommy „TC“ Colones telefoniert und ihn gefragt, ob ich während meiner Station Week an dem Thema arbeiten kann. TC war sofort begeistert. An seinen freien Tagen begleitet er mich zu Interviews bei der Handelskammer in Columbia oder auch zu Bürgermeister Rick Danner in Greer. Überall ist man der Meinung, dass der US-Präsident die Handelsbeziehungen South Carolinas nicht versteht. Als Trump Importzölle für BMW androhte, erhielt der Konzern prompt viele beruhigende Anrufe, auch aus dem Bürgermeisterbüro in Greer. Der Tenor: Solange der Staat es verhindern kann, wird sich nichts ändern.
In Spartanburg lerne ich auch TCs Arbeit kennen. Er ist Kameramann bei Channel 7 News WSPA, einem lokalen Fernsehsender, der zu CBS gehört. Gleich nach meiner Ankunft berichtet TC über den Tag der offenen Tür der örtlichen Feuerwehr. Oft hat er Reporter dabei, aber diesen Termin erledigt er innerhalb von gut zwei Stunden als One-Man-Show. Erst bittet er den Feuerwehrsprecher zum kurzen Interview, dann dreht er Kinder an der Wasserspritze und bei einer Rauchübung, im Sender schneidet er daraus eine Minute zusammen, schreibt einen Text für den Moderator und schon geht das VOSOT (Voiceover-to-sound) auf Sendung. Für seinen deutschen Besuch plant TC neben dem Arbeitsalltag auch immer Ausflüge ein, wie in den bezaubernden Küstenort Charleston oder zu einem Stück Berliner Mauer.
Die Kollegen bei Channel 7 News WSPA arbeiten wahnsinnig schnell und effektiv. In der morgendlichen Sitzung sind die Reporter aus Spartanburg und dem angrenzenden County Greenville zugeschaltet und schlagen Themen vor. Währenddessen klicken sich die Redakteure auf ihren Smartphones durch News, die im Redaktionssystem aufpoppen. Was hier zum Aufmacher taugt ist klar: möglichst blutige Verbrechen, „if it bleeds it leads“. Die Berichte haben zwar oft nicht die Qualität des deutschen Fernsehens, aber bei den Leuten kommt es an. Als ich nach einer Woche am Flughafen auf meinen Abflug nach New York warte, sieht eine Verkäufer TCs Visitenkarte in meinem Geldbeutel. Sofort fragt sie, ob ich bei Channel 7 News arbeite. Das sei ihr absoluter Lieblingssender.
Und dann ist es soweit: Die letzte Woche vergeht wie im Flug. Wir sprechen mit CNN über die Trump-Berichterstattung und laufen durch die Studios von Anderson Cooper (nicht anwesend) und Richard Quest (macht Fotos mit uns). Wir sind beim NPR-Zulieferer Marketplace live bei den Wirtschaftsnachrichten dabei, eine Sendung, die jeden Tag 11 Millionen Hörer erreichen. Wir besuchen die Daily Show mit Trevor Noah und kochen und servieren Essen für Obdachlose in der St. James Church. Wir treffen, wie schon in Washington, amerikanische RIAS-Fellows. Und schließlich sitzen wir in einem Büro der deutschen Vertretung bei den Vereinten Nationen, sprechen ein letztes Mal über den US-Präsidenten und genießen ein letztes Mal den Blick auf New York. Drei intensive Wochen sind vorbei, aber natürlich geht es jetzt erst los. Wir sollen das Fellow-Netzwerk nutzen, hat RIAS Verwaltungsdirektor Erik Kirschbaum immer wieder betont. Das heißt: zusammen arbeiten. Das passiert bestimmt – mit den amerikanischen Kollegen oder auch den deutschen. Danke RIAS für diese tolle Zeit!
Neus Pérez, Deutsche Welle, Berlin
9. Oktober 2017, Dulles International Airport
Vor einem Jahr dachte kaum einer, dass Donald Trump es als Präsident in das Weiße Haus schaffen würde. Heute, nicht mal ein Jahr nach seinem Amtsantritt, hat er nicht nur die USA, sondern auch die ganze Welt auf den Kopf gestellt. Washington D.C. ist der perfekte Ort, um dieses Phänomen mitzuerleben, und alle möglichen Fragen zu stellen, auf die man aber nicht immer eine Antwort bekommt. Man bekommt dafür etwas viel Wertvolleres: eine neue Einstellung zum Land, eine neue Perspektive der Vereinigten Staaten, sowohl persönlich als auch beruflich. Und gerade das macht die Reise mit der RIAS Gruppe so spannend: 12 Deutsche Journalisten, die quer durch das Land reisen, ständig Fragen stellen und für drei Wochen zu einer kleinen Familie werden.
Washington D.C., die politische Hauptstadt überhaupt und the place to be, wenn man die US-Amerikanische Politik von innen betrachten möchte. Hier fühlt man sich wie in einer Parallelwelt. Von der Hauptstadt aus wird ein riesiges Land regiert, das momentan mehr gespaltet ist als je zuvor. Ich frage mich, wie viele der Abgeordneten und Senatoren etwas von dem Leben der Bewohner im deep America mitbekommen, ob sie sich tatsächlich mit Ihren Problemen identifizieren können und es ihnen gelingt, sich die Träume Millionen verschiedener Amerikaner vorzustellen.
Die US-Politik und die Entscheidungen, die in Washington D.C. getroffen werden, haben letztlich eine globale Wirkung und einen Effekt auf die Politik der ganzen Welt. Wir sind alle von Donald Trump betroffen. Dieses Erdbeben wird noch viele Tsunamis auslösen. Und so fühle ich mich: im Epizentrum einer Naturkatastrophe, wo alles weiß und schön ist und die Sonne scheint.
15. Oktober 2017, El Paso International Airport
Die Sonne scheint noch stärker in Texas und New Mexico. Hier ist alles intensiver: die Hitze, die Farben und wahrscheinlich auch die Menschen. Mexiko ist nur einige Kilometer entfernt und man spürt es überall. Am Essen, am Charakter der Leute, an der Sprache und an der Kultur. Nicht richtig US-amerikanisch, nicht richtig mexikanisch. Die Menschen haben eine spannende, interessante und ganz besondere eigene Identität.
Schon am ersten Tag besuche ich die Mauer, die die USA und Mexiko voneinander trennt. Zwei verschiedene Welten, die in New Mexico zusammen kommen und sich ziemlich gut verstehen, aber durch eine Mauer, Konflikte und Gewalt getrennt werden.
Meine station week in Las Cruces gibt mir die Möglichkeit mit Latinos in Kontakt zu kommen und deren Welt, Lebensart und Probleme mitzuerleben. Und wenn man schon so nah an Mexiko ist, dann lohnt es sich in das Nachbarland zu reisen. Mit meinen Gastgebern besuche ich Ciudad Juárez. Wir überqueren die Grenze, nur einige Meter, die sich fast wie eine komplette Weltreise anfühlen. Juárez ist tatsächlich eine komplett andere Welt. Die Lage ist ruhig, aber angespannt. Die Leute feiern auf den Straßen, trinken und tanzen an einem Freitag Abend. Aber alle wissen, dass es einer der gefährlichsten Orte der Welt ist, vor allem für Frauen. Ich habe das Gefühl, dass sie trotz allem, einfach leben. Denn das Leben zu genießen ist wahrscheinlich die radikalste Art und Weise die Mörder und die Gewalt abzulehnen.
21. Oktober 2017, New York City – La Guardia Airport
New York – Da, wo sich das Leben nie eine Pause nimmt, die Stadt, die niemals schläft. Ich bin aufgeregt nach ein paar Jahren wieder hier zu landen. Dieses Mal als Teilnehmerin eines Journalistenprogramms zusammen mit 11 anderen Kollegen, mit denen ich Erfahrungen sammle und teile. Jedes Meeting, Gespräch oder Redaktionsbesuch gibt mir die Hoffnung, dass die Krise im Journalismus nach all den Beschuldigungen und Verachtungen des US-Präsidenten vielleicht doch nicht so tief ist; dass sich die Medien und die Journalisten neu erfinden werden.
New York sorgt nochmal für Inspiration. In den letzten drei Wochen habe ich mehr Fragen gestellt, an mehr Debatten teilgenommen und mehr Notizen geschrieben als in den letzten Monaten in der Redaktion. Und das Tolle dieser Reise ist, dass diese Notizen, und vor allem diese Erfahrungen, mich für immer in meinem beruflichen – und natürlich auch privaten – Leben begleiten werden.
„If I can make it there, I’ll make it anywhere. It’s up to you. New York, New York…“
Charlotte Potts, Deutsche Welle, Berlin
„Everything is bigger in Texas!“ Das inoffizielle Motto des Bundesstaates kommt mir in den Sinn als ich auf der Texas State Fair, einem überdimensionalen Jahrmarkt in Dallas, vor dem Big Tex halt mache – die 16 Meter hohe Statue eines Cowboys, neben dem die amerikanische und texanische Flagge wehen. Es fällt mir schwer, ein Foto zu knipsen, ohne meine 1,5 Liter große Limonade zu verschütten. Mein Weg führt mich vorbei an Ständen mit texanischen Delikatessen, deren Existenz ich bislang nicht für möglich gehalten hätte: Frittierter Käsekuchen, frittierte Brownies, und für alle, die noch nicht genug haben, frittierter Speck. Ich hadere noch mit der Auswahl, als mich ein Cowboy zu einer Wild West Show einlädt – mit Stieren, Pferden, Mini-Cowboys und ausgewachsenen Cowgirls: ein echtes Spektakel. Die Texas State Fair ist der Abschluss meiner Station Week in Tyler, einer 100.000-Einwohner Stadt im Osten des Bundesstaates.
Schon vor Abflug hatte mir mein Gastgeber Lane Luckie erklärt: „In Tyler we are all about food, faith and family.“ Und so war es dann auch, wobei Essen tatsächlich an erster Stelle steht: An jeder Ecke Burger-Länden, BBQ-Stände und Eisdielen. Hungern muss hier keiner, was allerdings in den letzten Jahren dazu geführt hat, dass die Volksgesundheit im Osten des Bundesstaates eine der schlechtesten im Land ist. Der Gesundheitszustand der Bevölkerung hat der Region, die im weitesten Sinne auch zum „Bible Belt“, zum stark religiösen Teil der USA zählt, den Spitznamen „Stroke Belt“ eingetragen: der Schlaganfall-Gürtel. Davon allerdings profitiert die einheimische Wirtschaft – Krankenhäuser sind die boomende Branche der Region. Kurioserweise empfinden viele Konservative, mit denen ich im Laufe der Woche spreche, Obamacare, die allgemeine Krankenversicherung, weiterhin als Zumutung.
Mein Gastgeber Lane Luckie ist der Moderator des osttexanischen Morgenmagazins beim Privat-Sender und ABC-Affiliate KLTV und in der Gegend stark verdrahtet: Ich treffe unter anderem den Bürgermeister von Tyler, eine erzkonservative Aktivistin, die Reporter und Manager des Senders und bekomme „Behind the Scenes“-Führungen im TV-Museum und bei der Lokalzeitung. Die Menschen in Tyler leben das Motto des Senders: „Proud of East Texas“. KLTV ist der Marktführer in der Region; der Fokus liegt auf Lokalnachrichten, Bundespolitik findet selten einen Platz in der Sendung. Das ist auch besser so, wird mir vom Manager des Senders erklärt, denn viele Zuschauer sorgen sich in diesen Tagen um die politische Ausrichtung von KLTV als Tochterunternehmen des eher progressiven nationalen Senders ABC. Tyler, Texas ist nämlich Herzland des Konservatismus in all seinen Ausprägungen – und seit Donald Trump im fernen Washington an der Macht ist, hat sich auch der Osten Texas’ noch weiter politisiert und polarisiert. Die Medien als Feindbild Nummer Eins – Trumps Mantra ist auch nach Tyler geschwappt. Wenige Monate vor meinem Besuch protestierten aufgebrachte Bürger vor den Türen des Senders. KLTV, seit jeher der größte Sender der Region mit den besten Einschaltquoten, kämpft in diesen Tagen um seine Deutungshoheit – im klassisch linearen Fernsehen und online.
Was mich überrascht: Konservativ geht nicht mit rückständig einher, vor allem nicht, was die digitale Entwicklung betrifft. KLTV hat sich schon lange den Zeiten angepasst („ohne Digitalstrategie hätten wir schon vor Jahren dicht machen müssen“): Es gibt zahlreiche Apps (neben der für Nachrichtenjunkies eine für Essensliebhaber, Wetterfanatiker oder High School Football Fans). Jeden Morgen zeichnen die Moderatoren nach ihren Sendungen ein Facebook Live auf, um den Zuschauer noch weiter an den Sender zu binden, während ihrer Sendung bedienen sie drei verschiedene Social Media Kanäle (ihre privaten und die des Senders). Ganz neu ist East Texas Now, eine Art Radiosendung fürs Fernsehen, moderiert von einer Person über die aktuellen Trends und Nachrichten der Region, acht Stunden ohne Pause, ausgestrahlt digital über Alexa oder Apple TV. Ich bin schwer beeindruckt vom Arbeitspensum der Redakteure und Journalisten. Und könnte noch soviel mehr zu Papier bringen: Zum Beispiel darüber wie Werbung und somit Geld den Sender regiert – und die kompliziert gewachsene Finanzierung der lokalen Fernsehsender in den USA den Arbeitsalltag der Journalisten bestimmt.
Es sind nur sechs Tage in Amerikas tiefem Süden, aber ich lerne viel: Vor allem auch über das Thema, über das ich mehr wissen wollte, wegen dem ich mit RIAS nach Amerika wollte: Trump und die USA unter Trump. Tyler zeichnet sich nämlich auch durch seine vielen ideologischen Stränge von Konservativen aus: Evangelikale Christen, Tea-Party-Anhänger, ehemalige Südstaaten-Demokraten, Hardcore-Republikaner, Trump-Fans; alles außer Demokraten. Auch wenn vielen hier der vormalige Tea-Party-Liebling Ted Cruz als Kandidat der Republikaner lieber gewesen wäre, ist man nach wie vor stolz auf Präsident Trump – und vor allem loyal. Nach noch nicht einmal einem Jahr, so der Tenor, könne man ihm doch nicht den Rücken zukehren. Manch einer findet die Tweets des Präsidenten zwar anstößig oder beleidigend, doch überwiegt entweder die Hoffnung, Trump könne Washington noch aufräumen oder ohnehin die Resignation, dass in der fernen Hauptstadt niemand etwas auf die Reihe bekäme. Ich verlasse Texas fasziniert und gefühlte zehn Kilo schwerer.
Fast sechs Jahre habe ich in Washington gelebt und das Land bereist: Nahezu Barack Obamas komplette zwei Amtszeiten habe ich in den USA verbracht. Deshalb ging es mir bei der RIAS-Reise vor allem um eines: Ich wollte den neuen Puls Amerikas erfühlen und der Frage nachgehen, was sich nun verändert hat unter Präsident Donald Trump. Meine Erkenntnis nach den drei Wochen: Eigentlich nicht viel. Der politische Tonfall ist ein wenig härter geworden und die Diskussionskultur schlechter. Allerdings sind das Entwicklungen, die bereits lange vor Trump eingesetzt haben.
Das Washington, das ich kennengelernt habe, hat sich aber doch zumindest äußerlich verändert: Auf der Pennsylvania Avenue prangt jetzt der Name Trump in goldenen Lettern rund um das alte Postgebäude, das jetzt ein Trump-Hotel ist. In der Lobby dort, so mein Eindruck beim Besuch, werden all diejenigen vorstellig, die die Nähe zum Präsidenten suchen, aber nicht ins Weiße Haus vorgelassen werden: chinesische Geschäftsmänner, junge, konservative Kapitol-Angestellte und die republikanische High Society der Stadt. Nicht nur die horrenden Preise für Instant-Kakao sind befremdlich. Eines meiner Highlights der Woche in Washington: Der Besuch der Konferenz der Wertkonservativen, bei dem Steve Bannon, der geschasste Chefstratege Trumps, auftritt und den Kampf gegen die republikanische Partei verkündet. Die populistische Revolte werde weitergehen und Trump auch 2020 gewinnen, verspricht Bannon, und wirkt inmitten jubelnder Konservativer durchaus glaubwürdig.
Immer wieder wird ja auch über den rebellischen Geist berichtet, der sich seit Trumps Wahlsieg im Land verbreitet – oder zumindest an den Küsten. Ansatzweise spüren wir diesen Kampfgeist wir in Washington und New York: Die ACLU beispielsweise verzeichnet einen Mitgliederanstieg, die Medienlandschaft bessere Einschaltquoten und neue Investigativ-Abteilungen: die Medien und gerade die Fernsehlandschaft sind stärker polarisiert als je zuvor, die Themen werden stärker politisiert. Doch die große Frage bleibt: Wer hört zu? Wenn immer nur diejenigen einschalten, die sich in ihren Meinungen durch die Meinungen des Senders bestätigt fühlen, erfüllt der Journalismus dann noch seine Aufgabe? In diesen Zeiten hinter die Kulissen der großen Sender wie CBS, CNN und NBC zu schauen und ein Verständnis für die Problemlagen und Arbeitsweisen der amerikanischen Kollegen zu entwickeln, ist ein unersetzliches Erlebnis, für das ich RIAS danke.
In diesen politisch bewegten Zeiten drei Wochen in den USA zu verbringen und hinter die Kulissen der US-Medienwelt zu blicken, ist eine einmalige Erfahrung gewesen. Beim letzten Abschied Ende 2015 verließ ich die USA mit zwei weinenden Augen. Diesmal weinte nur eines: Die Reise hat mich aufgewühlt: Weil ich wieder einmal feststellen musste, dass Bildung, Wohnraum und Gesundheit für so viele, die nach wie vor hart für ihren amerikanischen Traum arbeiten, unerschwinglich bleibt. Die angekündigte Steuerreform wird das wohl auf die Spitze treiben. Und gleichzeitig sind die Menschen so gastfreundlich wie eh und je; wer kann, der gibt auch (das weitverbreitete philanthropische Engagement konnten wir selbst erfahren, als wir Obdachlose in einer New Yorker Kirche bekochten) – das sind die Eigenschaften, die mein Herz für die USA immer höher schlagen lassen werden. Mein Fazit: Die USA bleiben ein gespaltenes Land – und mein Verhältnis zum Land auch. Vor allem aber bin ich dankbar, dass RIAS mir diese frischen Einblicke ermöglicht hat.
Christian Semm, Zweites Deutsches Fernsehen, Mainz
¨RIAS changed my life¨, dieser Satz begegnet einem immer wieder, wenn man mit RIAS und seinen Weggefährten zu tun hat. Vor allem hört man diesen Satz von Amerikanern, die durch RIAS eine ganz neue Welt kennenlernen durften. Ganz neue sind mir die USA zwar vor dem RIAS-Programm nicht, trotzdem beginne ich die Reise mit großer Neugier und Spannung, denn einerseits scheint man dieses Land ja irgendwie zu kennnen, aber dann gibt es immer wieder Momente wo es einem total fremd erscheint. Mehr verstehen will ich durch diese dreiwöchige Reise. Das wollen auch 11 andere Journalisten meiner RIAS-Gruppe, ein bunter Haufen aus Reportern und Moderatoren. Radio, Fernsehen, Nachrichtenagentur, alles dabei.
Unsere erste Woche startet in Washington, vollgepackt mit einem abwechslungsreichen Programm. Wir besuchen Radio- und TV-Stationen, Thinktanks, treffen Lobbyisten und Reporter. Was auffällt: Meist wird sehr offen mit uns gesprochen, über den Job, die Veränderungen durch die neue Regierung und auch Dinge, die vielleicht nicht so gut laufen. Offene Selbstkritik auch über Themen, die man als Medium versäumt oder falsch eingeschätzt hat. Das hört man in Deutschland nicht so oft. Was mir insgesamt gefällt: Diese herzliche und unbekümmerte Art mit der man hier empfangen wird.
Die meisten Termine erreichen wir zu Fuss, das Wetter ist überraschend mild für die Jahrezeit. Dadurch sehen wir sehr viel von der Stadt. Meine Vorstellung von Washington als eine eher langweilige Beamtenstadt erfüllt sich überhaupt nicht. Vieles erinnert hier an ¨House of Cards¨, dazu viele moderne Gebäude, gediegene Wohnviertel mit Vorzeigehäusern und Viertel wie Georgetown, das mich an London und Amsterdam erinnert.
Nach einer Washington-Woche fällt es fast schwer, alle Termine noch zu erinnern. Radio, Fernsehen, Deutsche Botschaft, Think Tanks, Lobbyisten und viele interessante Gespräche mit Leuten, die wir ohne das Programmn nicht getroffen hätten. Auch innerhalb unserer Gruppe wird viel diskutiert. Wir sind schnell der Meinung: Eine bessere RIAS-Gruppe hat es in all den Jahren noch nicht gegeben.
Doch nun heisst es erstmal: Trennung. Zeit für die Station-Week. Für mich geht es einmal quer durch`s Land nach Oregon, genauer gesagt nach Bend. Outdoor-Paradies für Wanderer, Biker und alle, die die Natur lieben. Der Ort umgeben von schneebedeckten Bergen dazu die leuchtenden Farben des Indian Summer. Hier begrüsst mich Lee Anderson, Anchor der Nachrichten beim Lokalsender KTVZ newschannel 21. Lee kennt Deutschland besser als so mancher Deutscher, war schon oft dort und ist glühender FC Bayern-Fan (was ich vergeblich versuchte zu ändern). Ich bin schon sein neunter RIAS-Fellow und werde bestimmt nicht der letzte sein. Durch Lee bekam ich Einblick in die Arbeit eines lokalen Nachrichtensenders. Ein junges Team an Reportern und Producern, die sehr professionell arbeiten und dabei auch noch Spass haben. Hier muss jeder alles können. Die Reporter drehen selbst, schneiden ihre Einspieler, überspielen ihr Material, organiseren ihre Live-Schalten, oder kommen ins Studio, um ihre Themen zu präsentieren, alles live und in hoher Schlagzahl. Beeindruckend. Ich bin mal im Studio oder begleite die Reporter beim Dreh und lerne viele nette Menschen kennen. Eine Woche hier ist viel zu kurz, ich muss wohl noch mal wieder kommen.
Nach einer Woche Station-Week, grosses Wiedersehen unserer Gruppe in New York. Für mich, völliges Kontrastprogramm zu Oregon. Statt Wald und Bergen, Grossstadtdschungel und Wolkenkratzer. Und wieder ein Woche voller spannender Termine und Begegnungen. CNN, CBS, NBC. Mich beeindrucken vor allem die TV-Studios der grossen Nachrichtensender. Wir dürfen fast überall hin und immer wieder treffen wir jemanden, der auch schon bei RIAS dabei war und Deutschland kennt, das Alumni-Netzwerk wird so lebendig und sichtbar. Ein Highlight dieser Woche: Die Arbeit in einer Obdachlosenküche einer Kirchengemeide in New York. Wir helfen mit, schnibbeln Gemüse, kochen, servieren und lernen so eine ganz andere Seite dieser Millionenstadt kennen.
Zum Schluss sind wir alle etwas traurig, dass das Programm vorbei ist, aber jeder ist glücklich über die gesammelten Eindrücke und Erfahrungen. Bei Themen wie der Gesundheitsreform lerne ich, dass es kein richtig oder falsch gibt. Ähnlich bei der Debatte über ein Waffenkontrollgesetz. Vielmehr ist es eine Art Kulturkampf, von aussen nicht immer leicht zu verstehen. Für mich bleiben die USA auch nach dieser Reise ein faszinierendes Land voller Widersprüche und grosser regionaler Unterschiede, beim Blick und Urteilen von Aussen lohnt es sich also zu differenzieren. Eine ältere Dame aus New York, mit der ich im Flieger von Oregon nach New York ins Gespräch komme, fasst es so zusammen. ¨Ich als New Yorkerin habe viel mehr Ähnlichkeit mit Dir als Europäer, als mit einem Amerikaner, der zum Beispiel aus Arizona kommt. Der ist auch mir total fremd¨. Von dieser Reise werde ich noch lange zehren und ich bin sehr dankbar, dass ich an diesem Programm teilnehmen konnte. Nun freue mich, Mitglied der RIAS-Familie zu sein.
Ralph Szepanski, Zweites Deutsches Fernsehen, Mainz
Las Vegas! Cool, da war ich noch nie. Das war mein erster Gedanke, als Erik, der RIAS-Chef, mich anrief. Eine Woche Washington und eine weitere in New York sind als Gruppe gesetzt. In der Woche dazwischen sind wir, die teilnehmen dürfen, irgendwo in Amerika allein unterwegs. Las Vegas also. Lässig. Wenige Tage später wollte es das Schicksal, wenn es denn so etwas gibt, dass ein bis in den Irrsinn aufgerüsteter „Einsamer Wolf“ das Spielerparadies tief in ein Blutbad taucht. Er feuert hundertfach in die Zuschauermenge eines Konzerts und tötet 58 Menschen. Wie ich später erleben sollte, hat das die Stadt nachhaltig verwundet, ohne allerdings die Diskussion um schärfere Waffengesetze im Geringsten zu verändern.
Als Nachrichtenmann im ZDF ist es der Anspruch an uns und an uns selbst, die Welt zu erklären. Dafür muss man sie verstehen. Und ich gebe unumwunden zu: Das mit Trump habe ich nicht verstanden. Wie kann ein Land, das uns mit Obama an der Spitze so vertraut erschien, derart in ein anderes Extrem verfallen? Ich wollte mir ein Bild machen. Und RIAS bot den perfekten Rahmen dafür. Drei Wochen Programm, drei Städte, hundert Termine und tausend Eindrücke, aus denen sich das Bild, die Antwort, die keine einfache ist, wie ein Mosaik zusammensetzt.
Den Auftakt macht Washington. Ich war lange nicht da. Die Stadt ist auf den ersten Blick so schön wie damals. Doch dann wird offensichtlich, dass hier kein Stein mehr auf dem anderen steht. Keine Begegnung, in der man nicht binnen Sekunden auf Trump zu sprechen kommt. Das Pew Research Center, ein fact-tank, wie sie sich dort nennen und verstehen, belegt mit Zahlen, wie rapide America´s global image in den freien Fall übergegangen ist. Lediglich Israel und Russland bewerten Trump positiver als Obama. Aber auch innerhalb Amerikas ändern sich die Zeichen der Zeit: Das Vertrauen ins Fernsehen als Medium hat mit Trump massiv verloren. Muslime werden pauschal diskriminiert.
Brookings, buchstäblich eine Institution in Washington, eine Denkfabrik mit Leuten, die wissen, wie Regieren geht, räumt unverhohlen ein: Wir haben Trump nicht kommen sehen. Constanze Stelzenmüller sagt das. Und sie sieht unglücklich dabei aus. Aber auch die anderen Gedanken, die sie entwickelt und ausführt, hellen ihre Stimmung nicht auf: In Washington werde unter der neuen Administration eine neue Denke manifestiert. Eine, die Kultur- und Handelskriege will; mit der Überzeugung, dass sie gewonnen werden können. „Im deutsch-amerikanischen Bündnis haben sich die Interessen genau umgekehrt.“ Sie glaubt, dass Trumps Twittereien vielleicht verhallen mögen, in der Welt aber eine tektonische Machtverschiebung bewirken. Europa sollte, China wird das neue Vakuum füllen.
Den imposantesten Blick auf die Macht genießen wir auf dem Dach von NBC. Vis a vis des Capitols; eine Pole-Position für jeden Hauptstadt-Korrespondenten. Unter dem Dach von NBC ist auch Telemundo. Sie machen Programm für 53 Millionen Latinos in den USA; alles andere als eine homogene gesellschaftliche Gruppe. Mexikaner, Puerto Ricaner, Kubaner; alle denken und wollen etwas anderes. Das einzige, was sie vereint, ist, dass sie von weißen Trump-Anhängern als Gefahr gesehen werden. Denn keine andere Bevölkerungsgruppe wächst so rasant wie die Latinos und steht derart für Veränderung.
Einer, dem all das keine Sorgen zu machen scheint, ist der deutsche Botschafter. Nachdem wir mit unseren Fragen fast eine Stunde von seinem Adlatus vertröstet werden, begrüßt er uns schließlich mit den Worten: „Komme gerade aus dem Weißen Haus, wichtige Sache, die Iran-Resolution, musste das eben nach Berlin weitergeben…“, um dann sehr entschieden darauf zu dringen, wie gut nach wie vor das deutsch-amerikanische Verhältnis sei. Nach der dritten Nachfrage zu Trump reagiert er ebenso irritiert wie scharf. Dass der Präsident drei Tage brauchte, um Merkel zum Wahlsieg zu gratulieren – nebensächlich. Dass er Merkel im Oval Office nicht die Hand schütteln wollte – so nicht wahr, Trump habe sie schlicht nicht gehört. „What?“ – schreit ein paar Stunden später ein Fotoreporter, dem wir das erzählen und der damals dabei war. Nicht gehört? Jeder im Oval Office habe den Ruf gehört: „Shake hands, shake hands!“ Trump habe sich stur gestellt; ein Affront! Stolz zeigt er uns sein Bündel an Ausweisen: White House, Capitol, Pentagon: er kommt überall rein. Und er ist ganz hingerissen von Ivanka Trump. So schön, so professionell. Ganz anders als Michelle Obama. Es ist ein Treffen an diesem Abend von Militärreportern; in Arlington, nicht weit vom Friedhof. Einige schwärmen von ihrem Einsatz damals; embedded im Irak-Krieg: „Wow! It took ten days. We blasted them away!“ Andere sorgen sich um das Ansehen Amerikas und vor einem Krieg mit Nordkorea. John Donnelly, der Vorsitzende dieser Vereinigung, hat tiefe Falten auf der Stirn. Immerhin sei der 1. Mann im Pentagon ein guter! Sehr besonnen, sehr erfahren. Ich lerne, dass Spitznamen – man nennt ihn Mad Dog – sehr relativ sind in Zeiten wie diesen. Und ich erlebe, dass die amerikanische Freundlichkeit nicht immer nur oberflächlich ist; als ich John sage, dass ich nach Las Vegas reisen werde, erzählt er von Michael, einem Freund, der mittendrin war im „Shooting“. Er könne den Kontakt herstellen. Ich nehme sehr dankbar an.
Der letzte Tag in Washington hingegen ist ganz unzweideutig. Das „Values Voter Summit“ trifft sich in der Stadt; allerlei rechtes Volk mit abstrusen Ansichten und Forderungen, allesamt glühende Verfechter von Trump. „Concerned women“; Prediger, die uns ins Gewissen reden, Sex vor der Ehe sei schlecht; andere sind überzeugt, schwul kann man heilen: „Ex-gay is ok“! Und immer wieder: „Hands off my gun!“
Im großen Saal betritt Steve Bannon die Bühne. Zunächst steht er hinter einem Pult. Schnell aber kommt er dichter, findet das Licht. Kein Zettel, kein Manuskript. Seine absolute Treue zu Trump ist verinnerlicht. Wurde er nicht gerade abserviert? Mitnichten. Es scheint, er trat zurück in die zweite Reihe, um von dort aus das Netz zu spinnen für die kommenden Wahlen. Er schwört das Publikum, das ihm elektrisiert an den Lippen klebt, ein auf den Kampf dieser Gleichgesinnten: „It´s not my war. It´s our war!“ Es gelte, sich das Land zurück zu holen. Eine Kriegserklärung an die andere Hälfte des eigenen Volkes – und der Saal tobt.
Als ich wenig später im Flugzeug nach Las Vegas sitze, schaut mein Sitznachbar auf seinem Laptop „House of cards“. Dieser Vorspann wirkt mit diesen Eindrücken im Kopf noch einmal eindrucksvoller. Und da ich so offensichtlich auf seinen Bildschirm starre, spricht er mich an. Ja, sage ich, die Serie kenne ich. Aber gerade sehe ich sie mit anderen Augen. Er erzählt, dass er im Auftrag der Army bald nach Europa reisen wird. Er müht sich, political correct zu bleiben. Und doch ist rauszuhören, wie sehr er sich darüber im Klaren ist, dass international gerade mehr verloren geht, als das Militär je wieder gewinnen kann.
Las Vegas hat andere Sorgen. Eine Stadt, von der es heißt, dass jeder Amerikaner zum Spaß mal hier gewesen sein muss! Einmal alles ausleben; sich dem Glücksspiel und allem anderen hingeben. Die „sin city“ -„what happens in Vegas stays in Vegas“! Nun aber ist etwas passiert, das nicht als süßes kleines Geheimnis dort bleibt. Das Areal vor dem Mandalay-Casino, wo das Blutbad stattfand, ist nach wie vor abgesperrt. Das FBI dreht jeden Stein um. Jeder Mitarbeiter wird stundenlang verhört. Der Betrieb freilich läuft weiter – The show must go on.
Tom ist mein „Host“ in dieser station week. Ein feiner Mann, der – wenn er spricht – auch etwas zu sagen hat. Er selbst war mit RIAS schon zweimal in Deutschland. Sein Sender, Channel-3, ist der größte Lokalsender der Stadt. In diesen Tagen werden die Quoten gemessen; es gilt, besonders gut zu sein. Er ist Reporter, bestens vernetzt in der Stadt. History begeistert ihn; kein leichtes Unterfangen in einer Stadt, die sich ständig häutet. Kommt ein Casino in die Jahre, wird es gesprengt. Er zeigt mir das Neon-Museum; ein Friedhof der Leuchtreklame. Ausrangierte Schriftzüge erinnern an die Zeiten, als das „Rat Pack“ oder Elvis die Stadt beherrschten. Und Tom tut es in seinen Beiträgen auch. Aber hier im Sender ist niemand, der nur eine Sache macht. Er präsentiert in der Morning Show im Studio den Verkehr, dann klettert er aufs Dach, besteigt den Hubschrauber und berichtet live von dort über Staus und alles andere, was von oben Sinn macht. Durch die Sendung am Morgen führen die Wagners; extrem schnell, professionell, eingespielt. Kein Wunder. Sie sind ein Ehepaar. Zusammen leben und arbeiten, eine 24/7-Ehe. Sie plaudern mit mir, Sekunden, bevor sie wieder on air sind; zeichnen zwischen zwei Moderationen etwas für Facebook auf. Hier gibts keine Allüren oder den Ausruf „Ich muss mich konzentrieren!“. Sie machen es einfach.
Eins der 58 Opfer des Shootings war police officer. Die Polizei von Las Vegas ehrt ihn am Tag seiner Beerdigung mit einer Parade. Channel-3 ist live dabei. Kim Wagner ist dort, wo sie für die Opfer Kreuze aufgestellt haben; am berühmten „Welcome to fabulous Las Vegas“ -Schild. Eins der geschmückten Kreuze trägt das Bild des Polizisten. Sein Bruder steht dort. Er weint. Als Kim live drauf ist, geht sie hin, kniet nieder vor dem Kreuz und weint ebenfalls. Und es ist dennoch kein Moment zum Fremdschämen, denn sie meint es so. Sie, die Menschen, die hier stehen, der Bruder, die Stadt, die Polizei-Parade, die in dem Moment vorbei fährt, während nur Meter entfernt am Schild die Touristen alberne Späße für Selfies machen – da ist mir klar, was sie meinen mit dem Hashtag lasvegasstrong, der auf jeder Fassade, auf jedem Polizei- und Feuerwehrwagen geschrieben steht. Und mir ist klar, dass ich diese Geschichte auch als Journalist erzählen sollte. Kim überlässt mir wie selbstverständlich ihren Kameramann. Wir treffen auch Michael, den Augenzeugen des Blutbads. Mit dem Stick in der Tasche, auf dem sie mir das Filmmaterial gezogen haben, aus dem ich tags drauf im ZDF-Studio zwei Beträge schneiden werde, fliege ich nach New York, der letzten Etappe.
Im Hotel gibts ein überschäumendes Wiedersehen. Aus allen Winkeln Amerikas zurück sind wir nun wieder die RIAS-Gruppe; jeder mit seiner Geschichte, die wir uns erzählen und die somit auch wieder ein gemeinsames Bild ergibt.
New York ist das genaue Gegenteil von Washington. Trump hat hier seinen Tower, aber nichts zu melden. Die Stadt ist sich einig in ihrer Ablehnung und Selbstgewissheit, sich von ihm in keiner Weise beeindrucken oder gar ändern zu lassen. Auch wenn er es versucht. Wir besuchen NBC; ein stolzer Sender im edlen Rockefeller Centre. „We are under attack“ sagen sie dort. Trump hatte gerade erst namentlich NBC an den Pranger getwittert. Bei CNN das gleiche Bild. Dort ist die ablehnende Haltung allerdings allzu offensichtlich und nahezu zur Obsession geworden. Sie arbeiten sich regelrecht an ihm ab. Das bringe Quote, geben sie im Gespräch zu, aber es fühle sich an wie im Hamsterrad. Eine Metapher, bei der ich denke: Sie rennen, ohne vorwärts zu kommen. Bei CBS geht es weit weniger gehetzt zu. Wir dürfen zu „60 minutes“. Das meist gesehene Newsformat Amerikas; seit nunmehr 50 Jahren. Sie nehmen sich Zeit und viel Geld, um ihre Reportagen zu realisieren. Und sie sind nicht von Selbstzweifeln geplagt: Das ist der beste Job im Journalismus – mit Abstand, sagt Bill Whitaker, der sich als einer der Korrespondenten viel Zeit für uns nimmt. Und der auch sehr ruhig und unmissverständlich die Haltung dieses Erfolgsformates vertritt: Das einzige Kriterium ist die Qualität. Wenn eine Story hier in dem kleinen Kino, in dem wir sitzen, bei der Abnahme durchfällt, muss sie überarbeitet werden. 3, 4 mal, wenn es sein muss. Oder sie verschwindet im Archiv, egal, wie teuer sie war. Und ich denke: Das muss man sich nicht nur leisten können. Das muss man sich auch leisten wollen. Und nur so bleibt man wohl die Nummer eins.
Von allen weiteren Terminen nur noch ein letztes Wort zu zwei Begegnungen, die mich berührten. Im Jewish Institute werden wir sehr nobel empfangen und bewirtet. Der Vorsitzende spricht wie Kissinger. Sehr tief, sehr langsam, sehr überzeugt. Er bilanziert das Weltgeschehen durchaus subjektiv; Iran, die Zwei-Staaten-Lösung, Europas Schwäche. Seit Trump habe sich der Ton geändert im amerikanisch-israelischen Verhältnis. Das sei in den acht Obama-Jahren tief gestört gewesen. „All that keeps us awake“! Ja. So ist es wohl. Während ein Großteil der westlichen Welt gerade verwundert aufwacht aus diesem amerikanischen Traum, ist Israel seit jeher gezwungen und daran gewöhnt, hellwach zu sein. Man muss sich diese Sichtweise nicht zu eigen machen, aber es hilft beim Verständnis.
Und schließlich das Kochen für Obdachlose in einer Kirchengemeinde. Wir werden eingewiesen und zugeteilt in der Küche von älteren Damen, die das hier immer wieder machen für jene, die nicht Schritt halten können im American way of life. Die einen schneiden und schälen, die anderen rühren und mixen. Die Lady bei uns am Herd dürfte weit über 80 sein. Wir machen Selfies und lachen viel. Als wir das Essen servieren, ist der Saal voll. In dieser reichen Stadt fällt man schnell sehr tief. Jonathan spricht mich an und fragt, was ich ich von Trump halte. Ich entgegne; deshalb sei ich hier, um das zu verstehen. Nie hätte ich für möglich gehalten, dass nach dem ersten schwarzen Präsidenten jemand wie Trump gewählt werde. Er sagt nur: Nicht obwohl Obama Präsident war kam Trump, sondern weil. Das meinten jene Weiße, wenn sie sagten, sie holen sich ihr Land zurück. Das ist der Grund, warum die Gesundheitsreform mit aller Macht zurück gedreht werden soll; weil sie Obamacare heißt. Der Name soll ausgelöscht werden. Als wir gehen, ist unsere Lady nicht mehr da. Aber eine andere erzählt, was sie vorher gesagt hat: dass ihre Familie im Holocaust ums Leben kam. Und dies heute der erste Tag gewesen sei, an dem sie mit Deutschen wieder gelacht habe.
Als ich zurück fliege nach diesen drei Wochen brauche ich einige Zeit, um wieder anzukommen in Deutschland. Da arbeitet etwas in mir. Vor allem aber spüre ich eine tiefe Dankbarkeit für diese wertvolle Erfahrung. Ein umfangreiches Programm, eine Bereicherung dank RIAS – aber auch dank der Gruppe aus lauter besonderen Menschen, mit denen ich so einhellig glücklich diese Zeit erlebte. Man kann es auch daran ablesen, dass wir uns nach wie vor mit Nachrichten und Nettigkeiten beschenken. Und das ist es wohl, was RIAS im Vorfeld immer wieder betonte: wir wollen, dass ihr Teil unserer Family werdet: Ein großes Netzwerk als reicher Erfahrungsschatz.
Benedikt Wenck, dpa, Berlin
Bei der Ankunft ist es heiß. Washington D.C. begrüßt seine Gäste Anfang Oktober mit um die 30 Grad – Celsius, wohl gemerkt. Auf einen angenehmeren Herbst als im kalten Berlin hatte ich mich ja eingerichtet, solch sommerliche Temperaturen sind dann aber doch etwas überraschend. Den Pulli über dem Koffer und gemeinsam mit den ersten Gefährten geht es nach Chinatown in Washington, wo wir für die nächste Woche in einem hipsterigen Hotel unser Zuhause haben werden. Und ich schwitze weniger wegen des warmen Wetters, sondern mehr vor Aufregung und Vorfreude auf all das, was uns hier in den USA bevorsteht.
Fernsehen ist nach wie vor das wichtigste Medium, mit dem sich die US-Amerikaner über Neuigkeiten informieren. Und so starte ich meinen Tag ähnlich wie Donald Trump: mit Fox & Friends – um mir ein Bild machen zu können, mit welchem Weltbild der irgendwie immer noch neue US-Präsident seinen Morgen beginnt. Dabei zu twittern unterlasse ich vorerst.
Dass sich die Bewohner dieses Landes bei ihrer News-Beschaffung hauptsächlich auf das Fernsehen verlassen, ist übrigens eine Information, die wir bei unserem ersten Termin im Pew Research Center lernen. Der selbsternannte „fact tank“ erstellt Studien und führt Umfragen durch. Eine davon: Wie hat sich das Bild der USA im Ausland nach der Wahl Trumps verändert? (Spoiler: Es hat sich nicht verbessert) Schon beim ersten Termin wird damit klar, was zunächst in Washington, dann später in New York auf uns wartet: Viele angeregte Diskussionen mit inspirierenden Menschen. Und immer wieder das Thema Trump.
Es gibt kaum einen Termin, bei dem wir nicht über den US-Präsidenten sprechen – auch, weil er bei uns viele Fragen aufwirft. Regelmäßig hören wir auch, dass niemand mit dessen Erfolg gerechnet hatte, ihn selbst eingeschlossen. Was wir aber ebenfalls hören, sind Erklärungen dafür, wie es Trump ins Weiße Haus geschafft hat. Etwa von Lori Montenegro, National Correspondent des spanisch-sprachigen Senders Telemundo, die uns nach einer ausgiebigen Selfie-Session auf dem Dach mit Blick auf das Kapitol und einer Führung durch die NBC-Studios aus ihrer beruflichen und privaten Vergangenheit erzählt. Und auch Antworten gibt darauf, warum Latinos in den USA für Trump gestimmt haben: viele haben gar nicht gewählt, weil sie politisch desinteressiert sind; sie sind legal hier und wollen ebenfalls keine illegalen Einwanderer im Land haben; viele von ihnen sind One-Issue-Voters, denen es beispielsweise genügt, wenn ein Kandidat sagt, er sei gegen Abtreibung. Nicht nur wegen der Selfies und des tollen Inputs ist der Besuch bei Lori ein absolutes Highlight der Woche in Washington – sondern auch wegen ihrer einnehmenden und offenen Persönlichkeit. Der Telemundo-Turnbeutel und der Telemundo Fidget Spinner taten ihr Übriges.
Ein weiteres Highlight der ersten Woche: der Besuch bei NPR. Wir sprechen mit Dominic Montanaro, Lead Editor Politics & Digital Audience – natürlich über den Präsidenten. „Trump lebt in den USA der 1970er und 80er Jahre“, sagt er. Und er betont, wie wichtig die Quellen sind, von denen die Nachrichten kommen. Geschichten müssen möglichst viele Quellen haben – und sie müssen absolut sicher sein. Kevin Beesley, Senior Europe Editor und sehr britisch, sagt: NPR könne sehr langweiliges Radio machen und sehr tief in politische Diskussionen einsteigen. Doch der Sender müsse eben auch unterhalten.
Was das bedeutet, erfahre ich in meiner zweiten Woche. Es geht nach Cincinnati, Ohio. Vielleicht nicht unbedingt die Stadt, an die man zuerst denkt, wenn es um die USA geht. Aber trotzdem eine spannende: Cincinnati hat in den letzten 65 Jahren knapp 200.000 Einwohner verloren – heute leben knapp 300.000 Menschen in der Stadt am Ohio River. Dass es hier bessere Zeiten gab, merke ich schon beim Einchecken ins Hotel: Das Millennium liegt sehr zentral in der Innenstadt, in der Lobby hängen Kronleuchter und es gibt einen großen Pool im vierten Stock. Doch der Putz bröckelt – buchstäblich. Downtown gibt es viele geschlossene Geschäfte, ein Drogeriemarkt ist tagelang geschlossen, weil die Kassensysteme ausgefallen sind. Und doch: Mit der Stadt geht es wieder bergauf. Es ziehen wieder mehr Menschen her, es gibt eine neue Tram-Linie – und der Star im Zoo, das Nilpferdmädchen Fiona, zieht Touristen aus dem ganzen Land an.
„If you go to the zoo, you have to see Fiona!“, sagt mir auch meine erste Gastgeberin, Ann Thompson. Eine Aufforderung, der ich wenige Tage später gerne nachkomme. Ann arbeitet bei WVXU, einem NPR Affiliate. Im Newsroom geht es relativ gemächlich zu: Fünf BerichterstatterInnen für Lokales, dazu ein Praktikant. Ann nimmt mich direkt mit ins Studio, sie liest Nachrichten. Und ich begleite sie zu einer Story: Anwohner bringen Kameras an, um Gegenden sicherer zu machen. Ann trifft sich mit ihnen und einem Police Officer – und spricht mit ihnen darüber, wie Cincinnati ein Stückchen sicherer und hübscher werden kann. Sehr aufschlussreich sind auch die Gespräche, die ich bei WVXU mit einigen Podcast-Machern habe. Unter anderem wird hier der Podcast „Looking Up“ produziert, zusammen mit dem Cincinnati Observatory.
Neben Ann habe ich sogar einen zweiten Gastgeber: Chris Knight ist Kameramann beim lokalen TV-Sender WLWT-TV5 und zeigt mir an meinem letzten Tag in Cincinnati, wie er arbeitet. Wir besuchen das für einen Lokalsender überraschend professionelle Studio, den großen Newsroom und nimmt mich zusammen mit der VJane und Moderatorin Megam Mitchell mit auf einen Termin. Die Uni Miami hat ihr Logo verändert, um der Geschichte des Miami-Volkes Tribut zu zollen. Eine kleine Änderung – und doch sind wir rund vier Stunden unterwegs, um die Geschichte fertigzumachen. Nahezu undenkbar in deutschen Verhältnissen, dieser Aufwand für diese Story. Doch täglich mehrere Stunden Lokalnachrichten zu füllen, senkt die Nachrichtenschwelle eben etwas.
An meinem letzten Tag darf ich auch noch einmal in die Studios von WVXU – diesmal als Gast. Denn die tägliche Talkshow „The Cincinnati Edition“ hat mich eingeladen, über meinen Besuch in den USA zu sprechen. Warum ich hier bin, was ich beruflich mache und wie mir Cincinnati gefällt. Und natürlich auch über: Trump. Und wie wir Deutschen den Präsidenten wahrnehmen.
Eine gute Vorbereitung auf die kommende Woche – und quasi die Heimatstadt Trumps, die das aber vermutlich nicht gerne hört. Und fast mehr als auf die Stadt freue ich mich auf das Wiedersehen mit den anderen der Gruppe. Den ersten Tag in New York haben wir frei. Wir nutzen ihn, um die Stadt zu entdecken: Central Park, High Line, Shopping, Essen. Und natürlich sprechen wir über die vergangene Woche – Eindrücke aus Texas, Las Vegas, Charlottesville, Atlanta oder Indianapolis.
Doch in New York steht uns auch ein straffes und vielfältiges Programm bevor. Erneut besuchen wir einige Redaktionen und Newsrooms. Darunter CNN – mit an vorderster Front im Kampf gegen die Unwahrheiten der Trump-Regierung. Die Redakteure, mit denen wir sprechen, fühlen sich wie in einem Hamsterrad. Dass Trump gut ablenken kann von den eigentlich wichtigen Dingen, das wissen sie hier. Und doch: Beim Durchsehen der letzten 20 Tweets des US-Präsidenten sei keiner dabei, der nicht berichtenswert wäre, heißt es. Mir kommt da eher die Frage in den Sinn, ob man damit nicht selbst Teil des Problems wird.
Schon von Berufswegen ganz anders setzt sich Tervor Noah mit dem Präsidenten auseinander. Wir dürfen bei der Aufzeichnung seiner Show dabei sein – eine der vielen Late Night Shows, die hier in New York produziert werden. Wir lachen viel. Vielleicht ein besserer Umgang mit der Person, die gerade alles dominiert hier in den USA.
Mehr als die Newsrooms, die wir in New York besuchen, beeindrucken mich allerdings die Menschen, die wir in dieser unglaublichen Stadt treffen. Sie sind es auch, die beispielsweise das Kochen für Obdachlose in der St. James Church spannend machen. Wir sprechen mit älteren Damen und Herren, die hier schon lange herkommen, um das Essen vorzubereiten und auszugeben. Es gibt Parmegan Chicken, Nudeln und Salat. Wir helfen beim Schnippeln, Kochen, Würzen – und später auch beim Servieren der Speisen. Auch hier kommen wir ins Gespräch mit den Menschen an den uns zugeteilten Tischen. Wo ich herkomme, werde ich gefragt. Was mich herführt. Und natürlich: Was ich von Trump halte.
Eine weitere Begegnung, die mich prägt, ist die mit Clare Toeniskoetter. Ein RIAS-Fellow, zur Zeit unseres Besuchs noch bei Marketplace, eine Woche später schon als Producerin bei „The Daily“, dem täglichen Podcast der New York Times. Beim ersten Treffen in einer überraschen günstigen Bar am Time Square nerden wir schon über Podcasts, tauschen uns aus über Lieblingsfolgen und -serien. Ein Kontakt, der ganz sicher bestehen bleibt, auch nach dem Ende des RIAS-Herbstprogramms 2017.
Ein bisschen „richtig“ arbeiten kann ich in New York auch. Während eines Termins seile ich mich ab und fahre mit dem Zug nach Newark. Dort besuche ich den Hörbuchanbieter Audible, bei dem mir dessen Podcast-Strategie für den deutschsprachigen Markt vorgestellt wird. Die Amazon-Tochter plant einen Start mit 17 neuen Serien – Details dazu gibt es im Gespräch mit den deutschen Pressevertretern und dem deutschen Podcast-Verantwortlichen des Unternehmens. Reiner Zufall, dass man sich in Newark trifft. Und eine neue Besonderheit dieser drei Wochen in den USA.
Die Möglichkeit, die Staaten auf diese Art und Weise kennenzulernen, wie es zum Teil nicht einmal die Bürger des Landes können, ist für mich eine auch im Nachhinein nur schwer fassbar. Ich bin unglaublich dankbar, teilnehmen zu dürfen und diese Erfahrungen in mein berufliches und privates Leben einfließen zu lassen. Die Gruppe mit Nural, Neus, Vanessa, Charlotte, Anja, Anja, Laura, Anorte, Christian, Ralph und Torsten habe ich dann schon auf dem Rückflug vermisst. Doch der Kontakt bleibt – als gemeinsame RIAS Fellows.